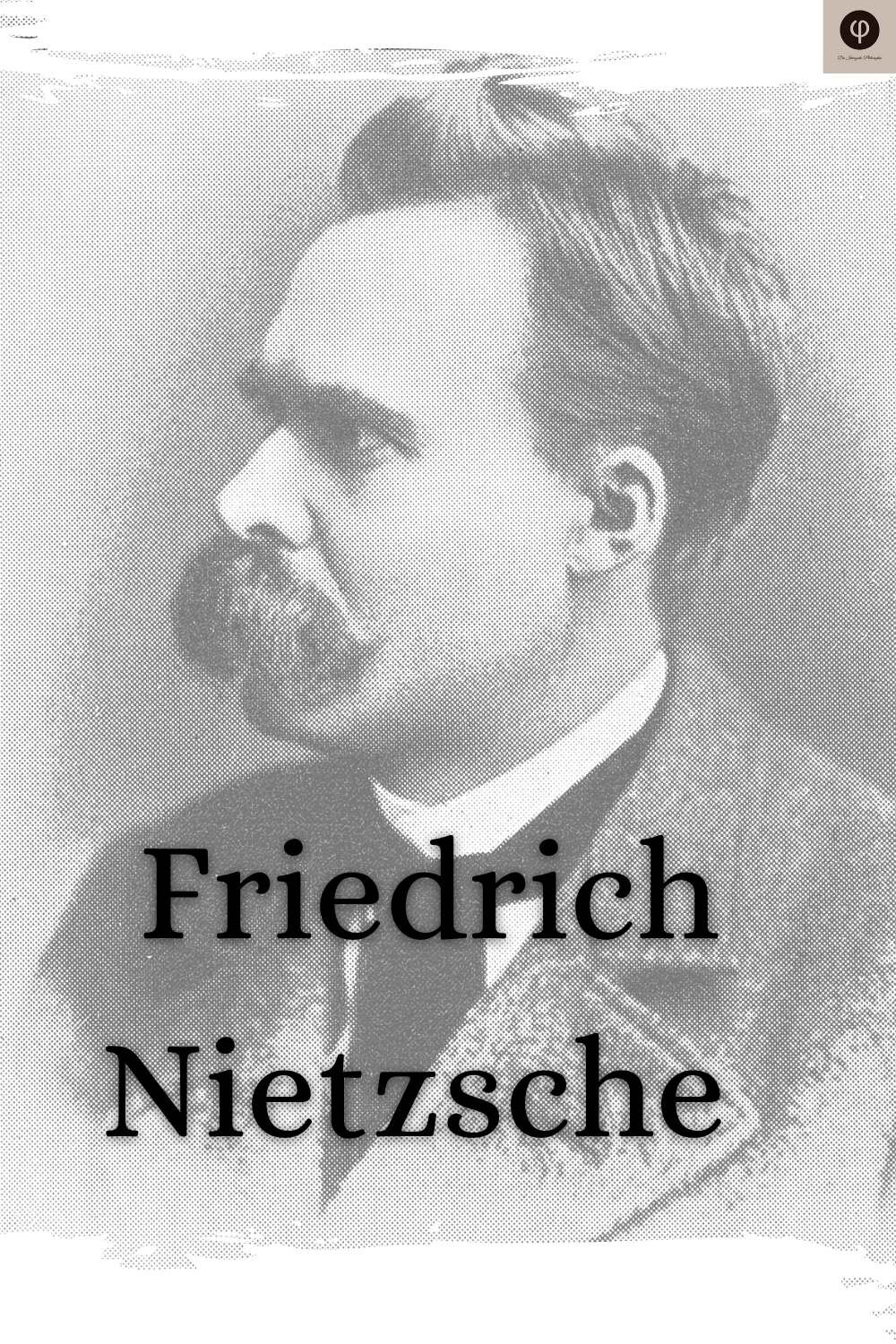Friedrich Nietzsche
(1844-1900)
Von: Die Inkognito-Philosophin
Friedrich Nietzsche (1844-1900), einer der tiefgründigsten und einflussreichsten modernen Philosophen, litt seit seiner Kindheit unter schweren Krankheiten wie Migräne und Depressionen.
Bereits mit 24 Jahren wurde er nach seinem Studium Professor für klassische Philologie in Basel. Aus gesundheitlichen Gründen musste er die Professur 10 Jahre später niederlegen.
Die Anerkennung als einer der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit erfolgte erst postum. Bezeichnend für Nietzsches Philosophie ist seine Religionskritik, die für jene Zeit ziemlich harsch ausfiel.
Seine Philosophie ist weiterhin durch seine Konzeption des „Übermenschen“, der „ewigen Wiederkunft“ und des „Willens zur Macht“ gekennzeichnet. Nietzsche forderte eine konsequente Umwandlung aller bestehenden Werte.
Nietzsche Zitate & Sprüche
– über Depression, Mensch & Welt
Nietzsche Zitate – “Unzeitgemäße Betrachtungen”
"Der Wahrheit dienen wenige in Wahrheit, weil nur wenige den reinen Willen haben gerecht zu sein und selbst von diesen wieder die wenigsten die Kraft, gerecht sein zu können."
Nietzsche - Zweites Stück, Kapitel 6
"Nein, das Ziel der Menschheit kann nicht am Ende liegen, sondern nur in ihren höchsten Exemplaren"
Nietzsche - Zweites Stück, Kapitel 9
"Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick zu verdienen: einmal als verschwimmende Copien der großen Männer, auf schlechtem Papier und mit abgenutzten Platten hergestellt, sodann als Widerstand gegen die Großen und endlich als Werkzeuge der Großen; im Übrigen hole sie der Teufel und die Statistik!"
Nietzsche - Zweites Stück, Kapitel 9
„Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.“
Die Vorstellung, nach durchgestandenem Leid wieder gestärkt hervorzugehen, hat etwas Heroisches an sich. Ob posttraumatisches Wachstum, Resilienz oder (Self-)Empowerment – Alles schöne Ideen, die aber nicht zu beweisen sind.
» Was dich nicht umbringt, macht dich stärker – Mythos: Wachstum nach Trauma
„Wozu du Einzelner da bist, das frage dich, und wenn es dir Keiner sagen kann, so versuche es nur einmal, den Sinn des Daseins gleichsam a posteriori zu rechtfertigen, dadurch, dass du dir selber einen Zweck, ein Ziel, ein Dazu, vorsetzest, ein hohes und edles Dazu.“
- Friedrich Nietzsche
Nietzsche über Nihilismus & Sinn des Lebens
Als Motto der Nihilisten zu Nietzsches Zeiten gilt Mephistopheles’ Ausspruch in Goethes Faust: „alles, was entsteht, / Ist wert, daß es zugrunde geht; / Drum besser wär’s, daß nichts entstünde“
Nietzsche differenziert die Nihilisten in passive (wie Schopenhauer) und reaktive (Sergey Nechayev). Nietzsche vertritt dagegen einen aktiven Nihilismus: durch dieses Konzept soll es möglich sein, alle Werte umzuwandeln und eine neue Welt zu schaffen, in der der Übermensch siegt.
„Wäre die Existenz einer [metaphysischen] Welt auch noch so gut bewiesen, so stünde doch fest, dass die gleichgültigste aller Erkenntnisse eben ihre Erkenntnis wäre: noch gleichgültiger als dem Schiffer in Sturmesgefahr die Erkenntnis von der chemischen Analysis des Wassers sein muss“
Der polarisierende Philosoph leugnete den Sinn der Kultur, der Wissenschaft und der Geschichte. Er war überzeugt, dass es eine allgemeine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht gebe und betonte dagegen die Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung des Individuums.
Das apollinische und dionysische Prinzip bei Nietzsche
Nietzsche denkt sich sinnstiftende Geschichte als Dialektik: das Gegeneinander einer produktiv gestaltenden Macht, die Formen schafft und in sich sinnvolle Einheiten des Erlebens ermöglicht, und einer zerstörerischen Gegenmacht, die alles wieder vernichtet – Wobei diese Auffassung von Dialektik strenggenommen keine ist: vgl. Dialektische Menschenbilder.
Die bildende Kraft ist „apollinisch“, der lustvollen Trieb der Vernichtung „dionysisch“.
„Wozu die Welt da ist, wozu die Menschheit da ist, soll uns einstweilen gar nicht kümmern, … aber wozu du Einzelner da bist, das frage dich.“
– Nietzsche
Nietzsche Zitate in Bildern
Nietzsches “Also sprach Zarathustra
“Also sprach Zarathustra” mit dem Untertitel Ein Buch für Alle und Keinen (1883–1885) ist eines von Friedrich Nietzsches berühmtesten Werken und in einer bemerkenswerten dichterisch-philosophischen Sprache gehalten. Durch die bilderreiche und lyrische Form gilt das Werk in der neuzeitlichen Philosophie als einzigartig.
Das faszinierende Hauptstück Nietzsches thematisiert die Ideen des Übermenschen und der ewigen Wiederkehr. Protagonist ist der Einsiedler Zarathustra (war ein persischer Religionsstifter) steigt nach vielen einsamen Jahren von seinem Berg herab und verkündet den Menschen seine Weisheiten.
Die wichtigste Message Nietzsches: "Gott ist tot"
Der "Übermensch" ist der Ersatz für die Idee Gottes. Nietzsche möchte damit ein Leitbild erschaffen, das den autonomen, selbstwirksamen Menschen zur Selbstbefreiung dienen soll. Zentral dabei ist der "Wille zur Macht": Wer etwas auf neue Weise denkt und gestaltet, der besitzt die Macht, die Welt zu verändern.
Die Idee der "ewigen Wiederkehr" soll dabei einen Halt geben, der den Menschen Trost und Sicherheit bietet. Da alles, was bisher in der Geschichte geschah, immer wieder geschieht und bereits unzählige Male wieder geschah, ist es Aufgabe des Menschen, sich dem Leben im Diesseits mit voller Hingabe zuzuwenden.
Nietzsche überwindet im Zarathustra den eigenen trostlosen Nihilismus und setzt an dessen Stelle ein Menschenbild, das gleichzeitig als Hoffnungsträger fungiert.
Nietzsche traf mit “Also sprach Zarathustra” den Zeitgeist seiner Mitmenschen. Seine Ideen wurden zum Leitmoment im Kampf gegen Dekadenz und Philistertum (Spießbürgertum). Die größte Wirkung hatte das Werk in der Literatur, Musik und bildenden Kunst.
Nietzsches Übermensch
„„Das Wort »Übermensch« zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlgeratenheit, im Gegensatz zu »modernen« Menschen, zu »guten« Menschen, zu Christen und andren Nihilisten – ein Wort, das im Munde eines Zarathustra, des Vernichters der Moral, ein sehr nachdenkliches Wort wird – ist fast überall mit voller Unschuld im Sinn derjenigen Werte verstanden worden, deren Gegensatz in der Figur Zarathustras zur Erscheinung gebracht worden ist: will sagen als »idealistischer« Typus einer höheren Art Mensch, halb »Heiliger«, halb »Genie« … Andres gelehrtes Hornvieh hat mich seinethalben des Darwinismus verdächtigt; selbst der von mir so boshaft abgelehnte »Heroen-Kultus« jenes großen Falschmünzers wider Wissen und Willen, Carlyles, ist darin wiedererkannt worden. Wem ich ins Ohr flüsterte, er solle sich eher nach einem Cesare Borgia als nach einem Parsifal umsehn, der traute seinen Ohren nicht.““
Laut Friedrich Nietzsche ist es die zentrale Lebensaufgabe des Menschen, einen Typus hervorzubringen, der höher entwickelt ist als er selbst. Diesen überlegenen Menschen nennt Nietzsche den Übermenschen (sowohl geistig als auch ideologisch). Nietzsche nutzt den Begriff Übermensch das erste Mal zur Bezeichnung Lord Byrons: „geisterbeherrschender Übermensch“.
Nietzsches Depressionen & Krankheiten
Nietzsche litt seit seiner Kindheit unter gesundheitlichen Problemen, u.a. Migräne, Depressionen, Schlafstörungen und Kurzsichtigkeit. Friedrich Nietzsche wurde in einem evangelischen Pfarrhaus von einer glaubenseifrigen Mutter erzogen. Er galt als fleißiger Schüler, bei dem alle eine Zukunft in der Theologie erwarteten. Doch schon als Jugendlicher haderte Nietzsche mit dem Christentum und strebte danach, sich davon zu lösen.
Vielleicht trug das alles dazu bei, dass Ende der 1880er Jahre gravierende psychische Symptome bei ihm auftraten.
Der geistige Zusammenbruch Nietzsches vollzog sich in verschiedenen Stufen, die in den ersten Jahren auch mit kurzzeitigen Aufhellungen verbunden waren.
Nietzsche selbst konsultierte zahlreiche Ärzte. Wärmere klimatische Bedingungen in Sorrent oder an der Riviera halfen nur kurzzeitig. Auch der tägliche Konsum von Chloralhydrat, einem Schlaf- und Beruhigungsmittel, wirkte lediglich palliativ.
Nach langen produktiven Schaffensperioden, in denen seine Hauptwerke entstanden, begann Nietzsche im Herbst 1888 sogenannte „Wahnsinnsbriefe“ zu versenden, kryptische Kurzmitteilungen mit Größenideen.
Nietzsche Spruch-Bilder
“Um allein zu leben, muss man ein Tier oder ein Gott sein — sagt Aristoteles. Fehlt der dritte Fall: Man muss beides sein — Philosoph…”
Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1889
Nietzsches geistiger Zusammenbruch
(Quelle: R. Safranski: Wie viel Wahrheit braucht der Mensch?)
Am 29.12.1888 schrieb Nietzsche in seinem Brief an Meta Salis; „Das Merkwürdigste ist hier in Turin eine vollkommene Fascination, die ich ausübe – in allen Ständen. Ich werde mit jedem Blick wie ein Fürst behandelt, – es giebt eine extreme Distinktion in der Art, wie man mir die Thür aufmacht, eine Speise vorsetzt. Jedes Gesicht verwandelt sich, wenn ich in ein großes Geschäft trete.“
Diese Passage klingt bereits verdächtig nach einer psychischen Pathologie.
Wenig später werden seine Schriften immer fanatischer: „Das höchste Gesetz des Lebens, von Zarathustra zuerst formuliert, verlangt, dass man ohne Mitleid sei mit allem Ausschluss und Abfall des Lebens, das man vernichte, was für das aufsteigende Leben bloß Hemmung, Gift, Verschwörung, unterirdische Gegnerschaft sein würde …“
Wenige Zeit später begibt sich Nietzsche zur belebten Piazza Carlo Alberto. Dort beobachtet er einen Kutscher, der auf sein Pferd einschlägt. Von Mitleid überwältigt stürzt sich der Philosoph beschützend dazwischen.
Der Mann, der zuvor noch so skrupellose Worte schrieb, bricht am Hals des Pferdes weinend zusammen. Fortan wird er
Nietzsches geistiger Verfall & Tod
Mit 45 Jahren litt Nietzsche bereits so sehr an Depressionen und Blindheit, dass er arbeitsunfähig wurde. Seit diesem Zeitpunkt war er auf die Pflege seiner Schwester angewiesen.
Im Herbst 1890 verschlechterte sich sein Geisteszustand rapide. "Es scheint nun, als ob der Wahnsinn zum Blödsinn umzuschlagen Miene macht", schrieb ein Jugendfreund im Februar 1891 an Overbeck. Nietzsche sprach nur noch wenig, wirkte zunehmend apathisch, zeigte selten ein Lächeln oder eine andere Reaktion außer unverhältnismäßiger Bewunderung. Sein Aussehen in jenen Jahren war hierzu kontrastierend auffällig gesund und frisch. Willen und Antrieb nahmen jedoch ab.
In der Baseler Krankenakte von 1889 finden sich folgende Einträge (11):
"11. Januar: Ganze Nacht nicht geschlafen. Sprach ohne Unterlaß. Stand öfters auf. Frühstückt mit großem Appetit. Fortwährend motorische Erregung. Legt sich zuweilen auf den Boden. Spricht verworren.
12. Januar: Fühlt sich so unendlich wohl, daß er dies höchstens in Musik ausdrücken könne.
13. Januar: Zeigt einen ungeheuren Appetit, verlangt immer wieder zu essen. Singt, johlt, schreit.
14. Januar: Fortwährend gesprochen und gesungen. Besuch der Mutter. "Mutter macht einen beschränkten Eindruck." Ein Bruder der Mutter starb in einer Nervenheilanstalt. Die Schwestern des Vaters waren hysterisch und etwas exzentrisch. (Angaben der Mutter.) Vater durch Fall von der Treppe hirnkrank. Nietzsche unterhält sich anfangs harmlos mit der Mutter, dann plötzlich: "Sieh in mir den Tyrannen von Turin." Redet dann verworren weiter.
15. Januar: Sehr laut. Laut schreiend und gestikulierend.
17. Januar: Parese des linken Facialis viel deutlicher Sprache: Keine nachweisbaren Störungen."(3)
Nietzsche erkannte alte Freunde nicht mehr, ab Herbst 1894 nur noch die Mutter, die Schwester und die Hausgehilfin Alwine. Nach dem Tod der Mutter im Jahr 1897, auf den Nietzsche in keiner erkennbaren Weise mehr reagierte, übernahm die Schwester Elisabeth 1890 die Pflege.
Sie hatte schon in den Räumlichkeiten in Naumburg ein Nietzsche-Archiv eingerichtet und zog dann mit dem Kranken und Alwine in eine repräsentative Villa nach Weimar. Ausgesuchte Besucher durften einen Blick auf den Kranken werfen, während Elisabeth Nietzsche raffiniert die Rechte an den Schriften ihres Bruders erwarb und das Nietzsche-Archiv regierte.
Friedrich Nietzsche verstarb am 25. August 1900 in Weimar an einer Lungenentzündung
Nietzsche, bis zum Beginn seiner Erkrankung kaum bekannt, wurde nun rasch berühmt. Die Krankheit Nietzsches hat ihrerseits zu dieser Polarisierung beigetragen. Für die einen wurde hierdurch ein Mythos begründet, der mit dem Begriffspaar Genie und Wahnsinn umschrieben werden kann, für die anderen war die Krankheit Nietzsches ein Beleg für das Pathologische in seinen Schriften.
Quellen:
1) D. Hemelsoet et al: The neurological illness of Friedrich Nietzsche (2008)
2) Dtv Lexikon der Philosophie
3) Johannes Wilkes: Nietzsches Krankheit: Genie und Wahnsinn (Deutsches Ärzteblatt 2000)
4) BIA PSY: Nietzsche, Friedrich (Biographisches Archiv der Psychiatrie)
Eure falsche Liebe zur Vergangenheit ist ein Raub an der Zukunft.
(Nachgelassene Fragmente. Sommer – Herbst 1883)
Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man.
(Also sprach Zarathustra)
Zitate von Nietzsche aus
”Menschliches, Allzumenschliches”
"Weg mit den bis zum Überdruss verbrauchten Wörtern Optimismus und Pessimismus! Denn der Anlass, sie zu gebrauchen, fehlt von Tag zu Tage mehr: nur die Schwätzer haben sie jetzt noch so unumgänglich nötig." - I, Aph. 28
"Zu den Dingen, welche einen Denker in Verzweiflung bringen können, gehört die Erkenntnis, dass das Unlogische für den Menschen nötig ist, und dass aus dem Unlogischen vieles Gutes entsteht." - I, Aph. 31.
"Auch der vernünftigste Mensch bedarf von Zeit zu Zeit wieder der Natur, das heißt seiner unlogischen Grundstellung zu allen Dingen." - I, Aph. 31
"Der Asket macht aus der Tugend eine Not." - I, Aph. 76
"Die Scham existiert überall, wo es ein »Mysterium« gibt." - I, Aph. 100
"Ohne die blinden Schüler ist noch nie der Einfluss eines Mannes und seines Werkes groß geworden. Einer Erkenntnis zum Siege verhelfen heißt oft nur: sie so mit der Dummheit verschwistern, dass das Schwergewicht der letzteren auch den Sieg für die erstere erzwingt." - I, Aph. 122
"Das Vollkommene soll nicht geworden sein. - Wir sind gewöhnt, bei allem Vollkommenen die Frage nach dem Werden zu unterlassen: sondern uns des Gegenwärtigen zu freuen, wie als ob es auf einen Zauberschlag aus dem Boden aufgestiegen sei." - I, Aph. 145
"Von der Tragödie begehrt das Volk eigentlich nicht mehr, als recht gerührt zu werden, um sich einmal ausweinen zu können." - I, Aph. 166
"Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave." - I, Aph. 283
"Die Tätigen rollen, wie der Stein rollt, gemäß der Dummheit der Mechanik." - I, Aph. 283
"Im Kampf mit der Dummheit werden die billigsten und sanftesten Menschen zuletzt brutal." - I, Aph. 362
"Gegen die Männerkrankheit der Selbstverachtung hilft es am sichersten, von einem klugen Weibe geliebt zu werden." - I, Aph. 384
"Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen."
- I, Aph. 483
"Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel." - I, Aph. 494
"Neid und Eifersucht sind die Schamteile der menschlichen Seele." - I, Aph. 503
"Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat." - I, Aph. 508
"Die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte der Anmaßungen." - I, Aph. 523
"Ein Beruf macht gedankenlos; darin liegt sein größter Segen. Denn er ist eine Schutzwehr, hinter welche man sich, wenn Bedenken und Sorgen allgemeiner Art Einen anfallen, erlaubtermaßen zurückziehen kann." - I, Aph. 537
"Von dem, was du erkennen und messen willst, musst du Abschied nehmen, wenigstens auf eine Zeit. Erst wenn du die Stadt verlassen hast, siehst du, wie hoch sich ihre Türme über die Häuser erheben." - II, 2. Aph. 307
"Dicht neben dem Wehe der Welt, und oft auf seinem vulkanischen Boden, hat der Mensch seine kleinen Gärten des Glücks angelegt." - I, Aph. 591
"Wer viel Freude hat, muss ein guter Mensch sein: aber vielleicht ist er nicht der Klügste, obwohl er gerade das erreicht, was der Klügste mit all seiner Klugheit erstrebt." - II, 1. Aph. 48
"Die Mutter der Ausschweifung ist nicht die Freude, sondern die Freudlosigkeit." - II, 1. Aph. 77
"Etwas Kurz-Gesagtes kann die Frucht und Ernte von vielem Lang-Gedachten sein." - II, 1. Aph. 127
"Man kritisiert einen Menschen, ein Buch am schärfsten, wenn man das Ideal desselben hinzeichnet." - II, 1. Aph. 157
"Die Insekten stechen, nicht aus Bosheit, sondern weil sie auch leben wollen: ebenso unsere Kritiker; sie wollen unser Blut, nicht unsern Schmerz." - II, 1. Aph. 164
"Der Witz ist das Epigramm auf den Tod eines Gefühls."
- II, 1. Aph. 202
"Tief denkende Menschen kommen sich im Verkehr mit anderen als Komödianten vor, weil sie sich da, um verstanden zu werden, immer erst eine Oberfläche anheucheln müssen." - II, 1. Aph. 232
"Das Publikum verwechselt leicht den, welcher im Trüben fischt, mit dem, welcher aus der Tiefe schöpft." - II, 1. Aph 262
"Im Gebirge der Wahrheit kletterst du nie umsonst; entweder du kommst schon heute weiter hinauf oder du übst deine Kräfte, um morgen höher steigen zu können." - II, 1. Aph. 358
"Der Gewissensbiss ist, wie der Biss des Hundes gegen einen Stein, eine Dummheit." - II, 2. Aph. 38
"Jedes Wort ist ein Vorurteil." - II, 2. Aph. 55
"Besser schreiben aber heißt zugleich auch besser denken; immer Mitteilenswerteres erfinden und es wirklich mitteilen können; übersetzbar werden für die Sprachen der Nachbarn; zugänglich sich dem Verständnisse jener Ausländer machen, welche unsere Sprache lernen; dahin wirken, dass alles Gute Gemeingut werde und den Freien alles frei stehe." - II, 2. Aph. 87
"Den Stil verbessern - das heißt den Gedanken verbessern, und gar nichts weiter! - Wer dies nicht sofort zugibt, ist auch nie davon zu überzeugen!" - II, 2. Aph. 131
"»Dumm wie ein Mann« sagen die Frauen: »feige wie ein Weib« sagen die Männer. Die Dummheit ist am Weibe das Unweibliche." - II, 2. Aph. 273
"Die demokratischen Einrichtungen sind Quarantäne-Anstalten gegen die alte Pest tyrannenhafter Gelüste: als solche sehr nützlich und sehr langweilig." - II, 2. Aph. 289
"Ich rede von der Demokratie als von etwas Kommendem. Das, was schon jetzt so heißt, unterscheidet sich von den älteren Regierungsformen allein dadurch, dass es mit neuen Pferden fährt: Die Straßen sind noch die alten, und die Räder sind auch noch die alten." - II, 2. Aph. 293
Wahrheit will keine Götter neben sich.
– Der Glaube an die Wahrheit
beginnt mit dem Zweifel an allen
bis dahin geglaubten Wahrheiten.
- Zitat Nietzsche aus Menschliches, Allzumenschliches
Nietzsche Zitate über Einsamkeit
„Allgemein ist die Hast, weil jeder auf der Flucht vor sich selbst ist, allgemein auch das scheue Verbergen dieser Hast, weil man zufrieden scheinen will und die scharfsichtigeren Zuschauer über sein Elend täuschen möchte, allgemein das Bedürfnis nach neuen klingenden Wort-Schellen, mit denen behängt das Leben etwas Lärmend-Festliches bekommen soll.“
In der Einsamkeit frisst sich der Einsame selbst auf, in der Vielsamkeit fressen ihn die Vielen. Nun wähle.
(Menschliches, Allzumenschliches)
Mir ist mitunter als ob ich als Längst-Gestorbener mir die Dinge und Menschen anschaute – sie bewegen, erschrecken und entzücken mich, ich bin ihnen aber ganz ferne.
Nietzsche, F., Briefe. An Paul Rée
Einsamkeit bei Friedrich Nietzsche
Der einsame Mensch ist für Nietzsche ein ungewöhnlicher Mensch (vgl. Schopenhauer als Erzieher § 3). Er ist heimatlos, weil er in den oberflächlichen Werten & Ansichten der Zeit keinen Halt findet. Das bedeutet zwar ein Leiden am Dasein, doch zugleich ist Einsamkeit die Voraussetzung zum Philosophieren.
Der „Einsame“ ist aber nicht sofort nihilistisch, lieblos, lebensverneinend. Genau andersherum: Er möchte neue Werte schaffen. Nietzsche hofft auf Mitstreiter. Immer wieder betont der Philosoph, sein Werk sei ein Verführungskunstwerk: darin sollen jene Heimatlosen ein Lebenskonzept erhalten.
Einsamkeit als Resonanzraum für Selbsterkenntnis
Wer etwas Neues schaffen will, muss in die Einsamkeit – so glaubt Nietzsche. In der Vereinsamung löst sich der Mensch von leidbringenden, überkommenen Denk- und Wertmustern und kann so einen neuen Lebenssinn für sich entwerfen.
„Ich bin die Einsamkeit als Mensch … Dass mich nie ein Wort erreicht hat, das zwang mich, mich selbst zu erreichen.“
Nietzsche beschreibt Einsamkeit als eine Entdeckung von Reaktions- und Deutungsmustern in einem selbst, die Konstitutionsmechanismen des Menschlichen darstellen. “In der Einsamkeit wird gewissermaßen alles größer, was man in sich birgt. Sie ist – unbeirrt ertragen – wie ein Brennglas auf seelische Regungen und Energien.” (Raphael Rauh)
Nietzsche Gedicht:
Vereinsamt (1887)
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein,
-Wohl dem, der jetzt noch - Heimat hat!
Nun stehst du starr,
Schaust rückwärts, ach! wie lange schon!
Was bist du Narr
Vor Winters in die Welt entflohn?
Die Welt - ein Tor
Zu tausend Wüsten stumm und kalt!
Wer das verlor,
Was du verlorst, macht nirgends Halt.
Nun stehst du bleich,
Zur Winter-Wanderschaft verflucht,
Dem Rauche gleich,
Der stets nach kältern Himmeln sucht.
Flieg, Vogel, schnarr
Dein Lied im Wüstenvogel-Ton!
Versteck, du Narr,
Dein blutend Herz in Eis und Hohn!
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein,
-Weh dem, der keine Heimat hat!
Zitat aus Ecce homo (1908) von Friedrich Nietzsche
„Man weiß von nichts loszukommen, man weiß mit nichts fertig zu werden, man weiß nichts zurückzustoßen – alles verletzt. Mensch und Ding kommen zudringlich nahe, die Erlebnisse treffen zu tief, die Erinnerung ist eine eiternde Wunde. (…)
Hiergegen hat der Kranke nur ein großes Heilmittel – ich nenne es den russischen Fatalismus, jenen Fatalismus ohne Revolte, mit dem sich ein russischer Soldat, dem der Feldzug zu hart wird, zuletzt in den Schnee legt. Nichts überhaupt mehr annehmen, an sich nehmen, in sich hineinnehmen – überhaupt nicht mehr reagieren …
Die große Vernunft dieses Fatalismus, der nicht immer nur der Mut zum Tode ist, als lebenerhaltend unter den lebensgefährlichsten Umständen, ist die Herabsetzung des Stoffwechsels, dessen Verlangsamung, eine Art Wille zum Winterschlaf. (…)
Weil man zu schnell sich verbrauchen würde, wenn man überhaupt reagierte, reagiert man gar nicht mehr: dies ist die Logik. Und mit nichts brennt man rascher ab, als mit den Ressentiments-Affekten (…)
Jener ,russische Fatalismus‘, von dem ich sprach, trat darin bei mir hervor, daß ich beinahe unerträgliche Lagen, Orte, Wohnungen, Gesellschaften, nachdem sie einmal, durch Zufall, gegeben waren, jahrelang zäh festhielt – es war besser, als sie ändern, als sie veränderbar zu fühlen – als sich gegen sie aufzulehnen (…)
Sich selbst wie ein Fatum nehmen, nicht sich ,anders‘ wollen – das ist in solchen Zuständen die große Vernunft selbst.“
Nietzsches Amor fati – “Sich selbst wie ein Fatum nehmen….”
Wie sollten wir handeln, wenn uns eine potenziell tödliche Gefahr bevorsteht? Nach Friedrich Nietzsche sollten wir uns unserem Schicksal ergeben und aufhören zu kämpfen. Doch wie kann es sinnvoll sein, aufzugeben? Und warum rät uns gerade Nietzsche, der als Denker des "Übermenschen" und des "Willens zur Macht" bekannt ist, dazu?
Das heutige Paradigma ist vom Neoliberalismus geprägt: Krisen sollen schnell überwunden werden, am besten indem man an ihnen wächst oder zumindest durchhält. Währenddessen sollten Individuen ihre Fähigkeiten und Leistungsfähigkeit optimieren, sei es durch das Erlernen einer neuen Sprache, Joggen, Renovieren der Wohnung etc.
Nietzsche beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der Liebe zum Leben, welche für ihn eine bedingungslose, entschiedene Zustimmung zu all den Widersprüchen bedeutet, die das Leben in sich birgt, wenn man genauer hinschaut. Durch dieses entschiedene Ja erlebt man sich selbst, als den Schöpfer seines eigenen Daseins, so Nietzsche.
Unsere Wahrnehmung beeinflusst maßgeblich, wie wir die Ereignisse unseres Lebens interpretieren und daraus sinnvolle Verknüpfungen erstellen. Wir formen unsere Eindrücke und passen sie an unsere Erkenntnisse an. Dabei trennen wir auch Faktoren voneinander und verbinden sie zu einem größeren Zusammenhang.
Im Zustand großer Erschöpfung verbraucht jede Reaktion nur weitere wertvolle Kraft. Vor allem, so wusste Nietzsche nur zu gut, zermürben Selbstvorwürfe.
Nietzsche verweilte aus diesem Grund, wie er aufzeichnet, lange Zeit ohne Widerstand in "unerträglichen" Umständen wie Orten, Wohnungen und Gesellschaften, um keine weitere Energie zu vergeuden. Die Akzeptanz des schmerzhaften Zustands, welche Nietzsche befürwortet, geht überaus weit.
Es bedarf nicht nur einer bloßen Toleranz, die von vielen derzeit widerstrebend ausgeübt wird. Vielmehr ist eine uneingeschränkte Zustimmung gefragt:
„daß man nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen – aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Notwendigen –, sondern es lieben.“
Nur wer das Amor Fati, die Liebe zum Schicksal, in sich trägt, vermag es, alle Widerstände zu überwinden, die an den Kräften zehren. Es ist von großer Bedeutung, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne sich eine andere Realität zu wünschen. Jedoch verbindet Nietzsche die bedingungslose und liebevolle Akzeptanz des Lebens mit einem ebenso radikalen Willen zur Gestaltung und Selbstentfaltung.
„Wenn irgend Etwas überhaupt gegen Krankheiten, gegen Schwachsein geltend gemacht werden muss, so ist es, dass in ihm der eigentliche Heilinstinkt, das ist der Wehr- und Waffen-Instinkt im Menschen mürbe wird. (…) Nichts überhaupt mehr annehmen, an sich nehmen, in sich hineinnehmen – überhaupt nicht mehr reagieren … Und mit nichts brennt man rascher ab, als mit den Ressentiments-Affekten (…)“
Währenddessen, dass man sich in dem fatalistischen Winterschlaf befindet und eine Pause einlegt, hat man auch die Chance für Selbstreflexion.
„Die Krankheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer vollkommnen Umkehr aller meiner Gewohnheiten; sie erlaubte, sie gebot mir Vergessen; sie beschenkte mich mit der Nötigung zum Stilliegen, zum Müßiggang, zum Warten und Geduldigsein … Aber das heißt ja denken!“
Laut Nietzsche stellt die Überflutung des modernen Menschen mit einer Vielzahl von Einflüssen wie Meinungen, Forderungen und Erwartungen ein grundlegendes Problem dar.
Der Mensch ist oft nicht in der Lage, sich gegen automatisierte Reaktionen auf diese Einflüsse zu wehren. Dies führt dazu, dass er schnell in Situationen und Handlungsmuster gerät, die er bei genauerer Betrachtung niemals gewählt hätte.
Es ist daher eine Herausforderung für den modernen Menschen, sich bewusst von diesen Einflüssen zu distanzieren und eine eigene, authentische Handlungsweise zu entwickeln.
Eine gründliche Entschleunigung ist notwendig, um wieder Klarheit zu erlangen und herauszufinden, was wirklich wichtig ist und welche Ziele man anstrebt. Wer hingegen in seiner Hektik durchs Dickicht rennt, wird sich nur noch weiter verirren und keinen Ausweg finden. Deshalb ist es ratsam, innezuhalten und bewusst zu reflektieren, um dann gestärkt und zielgerichtet voranzuschreiten.
Nietzsche erkannte erst in seinen langen Phasen der Krankheit und des Winterschlafs, wer er wirklich war und wurde sich seiner selbst bewusst.
„Mit einem Male war mir auf eine schreckliche Weise klar, wieviel Zeit bereits verschwendet sei – wie nutzlos, wie willkürlich sich meine ganze Philologen-Existenz an meiner Aufgabe ausnehme.“
Nachdem er jahrelang als Professor in Basel gearbeitet hatte, beschließt er, sich als freier Philosoph neu zu orientieren. Dabei erkennt er die Notwendigkeit, seine Umwelt und Ernährung den für ihn optimalen klimatischen Bedingungen anzupassen. Diese Erkenntnis bringt ihm eine tiefere Einsicht in seine Bedürfnisse und Überzeugungskraft ein.
„In meiner Basler Zeit war meine ganze geistige Diät, die Tages-Einteilung eingerechnet, ein vollkommen sinnloser Mißbrauch außerordentlicher Kräfte, ohne eine irgendwie den Verbrauch deckende Zufuhr von Kräften, ohne ein Nachdenken selbst über Verbrauch und Ersatz.“