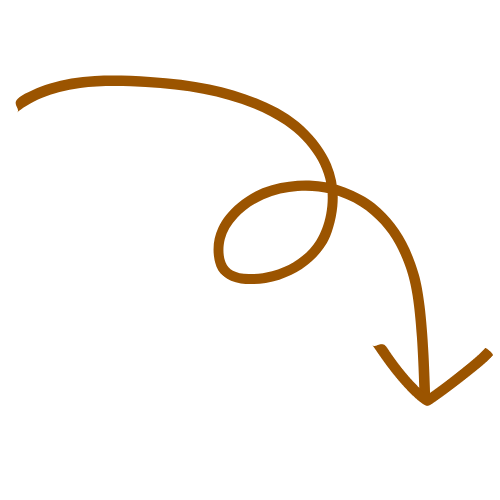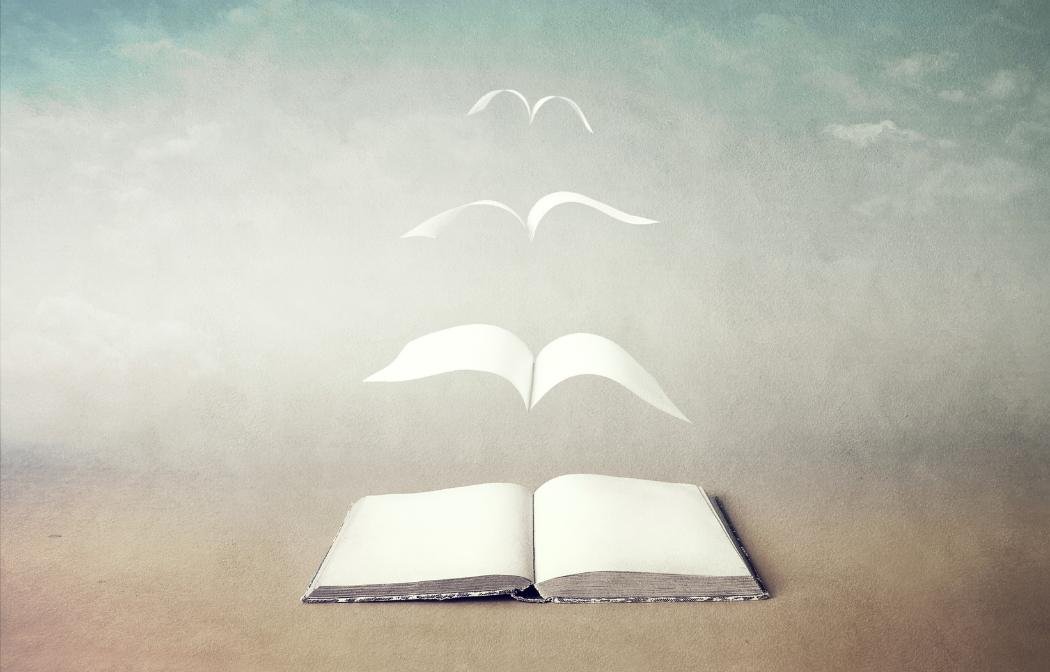
Existenzphilosophie
Existenzialismus
Autorin: Die Inkognito-Philosophin
Die Existenzphilosophie ist ein philosophischer Ansatz, der sich mit der individuellen Existenz beschäftigt. Im Gegensatz zu anderen Strömungen in der Philosophie, die nach einer allgemeingültigen Definition des menschlichen Wesens suchen, konzentriert sich die Existenzphilosophie auf das Leben des Einzelnen.
Ein Mensch ist immer einzigartig in seinem Dasein, kein anderer kann es exakt auf die gleiche Art und Weise führen. Jede Person macht ihre eigenen Erfahrungen und trifft Entscheidungen, die fest in der Zeit und in dem sozialen Umfeld verankert sind, in dem sie lebt. Wir sind nicht einfach austauschbare Exemplare einer Spezies, sondern jeder von uns prägt und wird geprägt von seiner persönlichen Geschichte und den Menschen und Ereignissen um ihn herum.
Kurz: Die Existenzphilosophie ermutigt uns, unsere individuelle Natur zu erkennen und bewusst zu leben.
Was ist Existenzphilosophie?
Definition & Bedeutung
Die Existenzphilosophie misst der subjektiven Lebenserfahrung eine wesentliche Bedeutung bei und wendet sich gegen jede Reduktion dieser Erfahrung auf abstrakte Konzepte oder Definitionen.
Existenzphilosophen sehen unser Welt- und Selbstverständnis durch tiefgreifende Erlebnisse geformt – wie zum Beispiel schweres Leid, das Scheitern bei einem wichtigen Vorhaben oder der Umgang mit dem Tod. Diese Erfahrungen, die man als Zufallserfahrungen oder „Kontingenzerfahrungen“ bezeichnet, lassen uns spüren, wie verletzlich und unvorhersehbar unser Leben ist, und fordern uns heraus, über den Sinn und die Beschaffenheit unserer individuellen Existenz nachzudenken.
Die Angst nimmt in der Existenzphilosophie eine spezielle Position ein. Als existenzielle Seinsweise, die nicht auf bestimmte Objekte beschränkt ist, isoliert sie das Individuum und konfrontiert es mit seinem haltlosen Dasein in der Welt. Siehe auch Wie fühlt sich Angst an?

Die existenzielle Philosophie in Deutschland
Die Existenzphilosophie entwickelt sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Søren Kierkegaards Konzept der individuellen menschlichen Existenz heraus. Sie wird sowohl von der Lebensphilosophie (Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Wilhelm Dilthey) als auch von Edmund Husserls Phänomenologie beeinflusst.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Karl Jaspers und Martin Heidegger als bedeutendsten Existenzphilosophen in Deutschland angesehen.
Eine gängige Bezeichnung als Synonym zur Existenzphilosophie oder auch speziell auf die französische Existenzphilosophie bezogen lautet „Existentialismus“.
Jean-Paul Sartre unterschied seinen atheistischen Existenzialismus deutlich von einer christlich-orientierten Existenzphilosophie.
Kierkegaards Aufwertung des Subjekts
Kierkegaard war einer der Ersten, der die menschliche Existenz nicht abstrakt begriff. Das menschliche Selbst war für ihn nicht eine festgelegte Entität, sondern ein dynamischer Prozess – ein Selbstverhältnis, das heißt eine Beziehung, die eine Person zu sich selbst unterhält.
Diese Selbsterfahrung beinhaltete Fragen wie "Wer bin ich?", "Was ist der Sinn meines Lebens?" oder "Wie soll ich leben?"
Kierkegaard kritisierte, dass Hegel und die anderen einflussreichen Philosophen seiner Zeit die tiefen, persönlichen und individuellen Aspekte des menschlichen Lebens verfehlten, insbesondere die ethischen und religiösen Erfahrungen.
Kierkegaard betonte, ein echtes Verständnis des menschlichen Daseins liege im persönlichen, im moralischen und im spirituellen Bereich des Lebens jedes Einzelnen, weit entfernt von den allgemeinen Theorien und Abstraktionen, die Hegels Philosophie kennzeichneten.
Die Existenz des Menschen beinhaltet für Kierkegaard vor allem eine widersprüchliche und rational nicht vollständig erfassbare Realität der Subjektivität (des Subjekts).

Phänomenologie & Existenzphilosophie
Darüber hinaus unterscheidet sich die Existenzphilosophie stark von dem, was seit René Descartes als grundlegend gilt – nämlich der Betonung des Bewusstseins als Grundlage der Philosophie. Descartes berühmter Ausspruch "Cogito, ergo sum" (Ich denke, also bin ich) stellte das Denken ins Zentrum der menschlichen Existenz.
Die Existenzphilosophie sieht das Leben als etwas an, das über das reine Denken hinausgeht und das theoretische Verständnis überschreitet. Sie betrachtet den Menschen als ein aktives Wesen, das schon in der Welt ist und in konkreten Situationen lebt.
Dabei untersucht die Existenzphilosophie grundlegende Aspekte der Erfahrung:
Leiblichkeit: Die körperliche Erfahrung und Präsenz in der Welt. Vgl.: Leib & Leiblichkeit – Körper haben, Leib sein
Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit: Wie wir Zeit erleben, wie sie unsere Vergangenheit unsere Gegenwart und Zukunft prägt und wie wir uns als Teil einer Geschichte begreifen. Vgl. auch Zeit, Zeitgefühl, Zeitsinn
Mitsein mit anderen: Unsere Beziehungen zu anderen Menschen und wie diese unsere Existenz beeinflussen. (Vgl. Intersubjektivität = Zwischenmenschlichkeit)
Die existenzielle Angst in der Existenzphilosophie
Die Angst spielt eine bedeutende Rolle in der Existenzphilosophie, da sie die Grundlage für die Entfaltung der individuellen Freiheit bildet. Als eine allgemeine Stimmung isoliert sie das individuelle Selbst und zwingt es dazu, sich mit dem grundlegenden Dasein in der Welt auseinanderzusetzen.
Die Angst wird als "Schwindel der Freiheit" bezeichnet (Kierkegaard) und macht einem Menschen bewusst, welche Möglichkeiten man hat und wie unbestimmt die Zukunft ist. Der Begriff der existenziellen Angst (Existenzängste) unterscheidet sich maßgeblich von einer krankhaften Phobie (wie Sozial-Phobien).
Das Selbst & die Anderen im Existenzialismus
Die Freiheit des Einzelnen ist untrennbar mit der Freiheit anderer Menschen verbunden.
Wenn wir über eigene Freiheiten sprechen, meinen wir damit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie wir unser Leben gestalten und welche Handlungen wir ausführen. Die Existenzphilosophie stellt jedoch klar, dass unsere Freiheit nicht in Isolation existiert. Wir leben in einer Welt voller anderer Menschen, und ihre Freiheit verdient genau so viel Respekt wie unsere eigene.
Die Idee dahinter:
Man kann seine eigene Freiheit nicht wirklich ausleben, wenn man gleichzeitig die Freiheit anderer Menschen missachtet.
Niemand kann sich auf eine Weise selbst verwirklichen, die anderen schadet oder sie in ihrer Freiheit einschränkt.
Authentisch frei, also wirklich man selbst zu sein und seine Freiheit zu leben, bedeutet auch, dass man den Raum für die Freiheit anderer lässt.
In der Praxis bedeutet das, dass in einer Gesellschaft, in der alle Individuen wahren Wert auf die Freiheit legen, es eine gegenseitige Anerkennung und Achtung der Freiheitsrechte geben muss. Dieser Respekt vor der Freiheit anderer ist nicht nur eine moralische Forderung, sondern auch eine Voraussetzung dafür, dass man selbst wirklich frei sein kann.

Sartres Existentialismus
Der Mensch ist „in die Freiheit geworfen“
„Mit einem Wort, der Mensch muss sich sein eigenes Wesen schaffen; indem er sich in die Welt wirft, in ihr leidet, in ihr kämpft, definiert er sich allmählich; und die Definition bleibt immer offen; man kann nicht sagen, was ein bestimmter Mensch ist, bevor er nicht gestorben ist, oder was die Menschheit ist, bevor sie nicht verschwunden ist.“
Sartre ist überzeugt, dass wir uns der Angst nicht durch den Rückgriff auf Selbstverständlichkeiten und Glaubenssysteme entziehen sollten, da sie uns zur Erkenntnis unserer Freiheit führt. Die Angst vor der Existenz eröffnet uns unzählige Optionen zur Wahl und bringt damit die Schrecken der Verantwortung für die Folgen unserer Entscheidungen mit sich.
Die Existenz ist das Fundament, auf dem die Essenz aufbaut. Der Mensch wird ohne vorgegebene Eigenschaften geboren (Existenz) und ist frei von jeglichen Wesensmerkmalen (Essenz).
Nach Sartre gibt uns die Natur keine Orientierung, keinen Hinweis auf einen Sinn oder Wert. Sie existiert einfach und ist neutral. Deshalb hat der Mensch absolute Freiheit.

„Zwei gewöhnliche Irrtümer: die Existenz geht der Essenz voraus oder die Essenz der Existenz. Sie gehen und erheben sich beide im gleichen Schritt.“
Camus’ Philosophie des Absurden
“Ein Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten”
Camus ist einer der bekanntesten existenzialistischen Literaten des 20. Jahrhunderts. Seine Philosophie hat jedoch einen eigenständigen Charakter. Sie wird daher oft als „Philosophie des Absurden“ betitelt.
Das Absurde entsteht aus der Sinnsuche des Menschen und der Sinnlosigkeit der Welt. Das Leid bleibt für ihn nicht nur sinnlos, es bleibt auch unerklärbar. Nach Camus fühle „der Mensch“, wie fremd ihm alles sei, und erkenne dabei die Sinnlosigkeit der Welt; so stürze er in seinem Sinnstreben in tiefste existenzielle Krisen.
Um nicht verzweifelt zu resignieren oder in Passivität zu verfallen, propagiert Camus im Sinne der Existenzphilosophie und in Anlehnung an Friedrich Nietzsche den aktiven, auf sich allein gestellten Menschen.
Dieser entwickelt unabhängig und selbstbestimmt ein Bewusstsein neuer Möglichkeiten der Schicksalsüberwindung, der Auflehnung, des Widerspruchs und der Revolte.
Die Bedeutung von Freiheit zieht sich ebenfalls wie ein roter Faden durch das Werk von Camus. Doch seine These weicht von Sartres ab: Mensch und Natur stehen für ihn keineswegs in einem unüberwindbaren Gegensatz zueinander, da der Mensch untrennbar mit der Natur verbunden ist und folglich auch natürliche Charakteristika aufweist.

Jaspers Existenzphilosophie
“Der Mensch wird, was er wird, durch die Sache, die er zu der seinen macht.”
„Situation wird zur Grenzsituation, wenn sie das Subjekt durch radikale Erschütterung seines Daseins zur Existenz erweckt.“
Jaspers gilt als DER führende Vertreter der existenzialistischen Philosophie. Allerdings sah Jaspers selbst einen strikten Unterschied zwischen seiner Existenzphilosophie und Sartres Existentialismus. Er interessierte sich vor allem für die seelischen Antriebe, die Weltanschauungen begründen.
Ein besonderes Augenmerk legte Jaspers auf „Grenzsituationen“, wie Verlust, Leiden, Schuld und Vergänglichkeit. Sie alle prägen die Erfahrungen des Menschen, gleichzeitig scheitert er daran mit rationalem Denken. Doch Skeptizismus und Nihilismus lassen sich nur überwinden, indem er sich als Existenz gegenüber der Transzendenz bewusst wird.
Jaspers unterschied wissenschaftliche Wahrheit von existenzieller Wahrheit. Während die eine intersubjektiv nachvollziehbar ist, könne man bei der anderen nicht von Erkenntnis sprechen, da sie sich auf transzendente Gegenstände (Gott, Freiheit) richtet.
Seine Philosophie ist geprägt von einem Verständnis des Individuums als freies Wesen, das in Interaktion mit anderen seine eigenen Ideen und Handlungen entwickeln muss. Im Gegensatz zu Ideologen, die absolute Wahrheit für ihre Philosophie beanspruchen, war Jaspers stets darum bemüht, eine offene und dialogische Haltung einzunehmen. Er betonte die Bedeutung des individuellen Denkens und Handelns in einer Welt, die von Veränderung und Unsicherheit geprägt ist.
Der Ursprung der Frage nach dem Sinn des Daseins und der Erkenntnis beginnt an dem Punkt, an dem alle wissenschaftlichen und rationalen Methoden keine Antworten mehr bieten.
Die Ansätze Jaspers sind keineswegs bloße metaphysische Spekulationen, sondern verdeutlichen die Bedeutung der Entscheidungsfindung und Verantwortung des Individuums in seiner Freiheit. Vgl. auch Philosophie der Psychiatrie