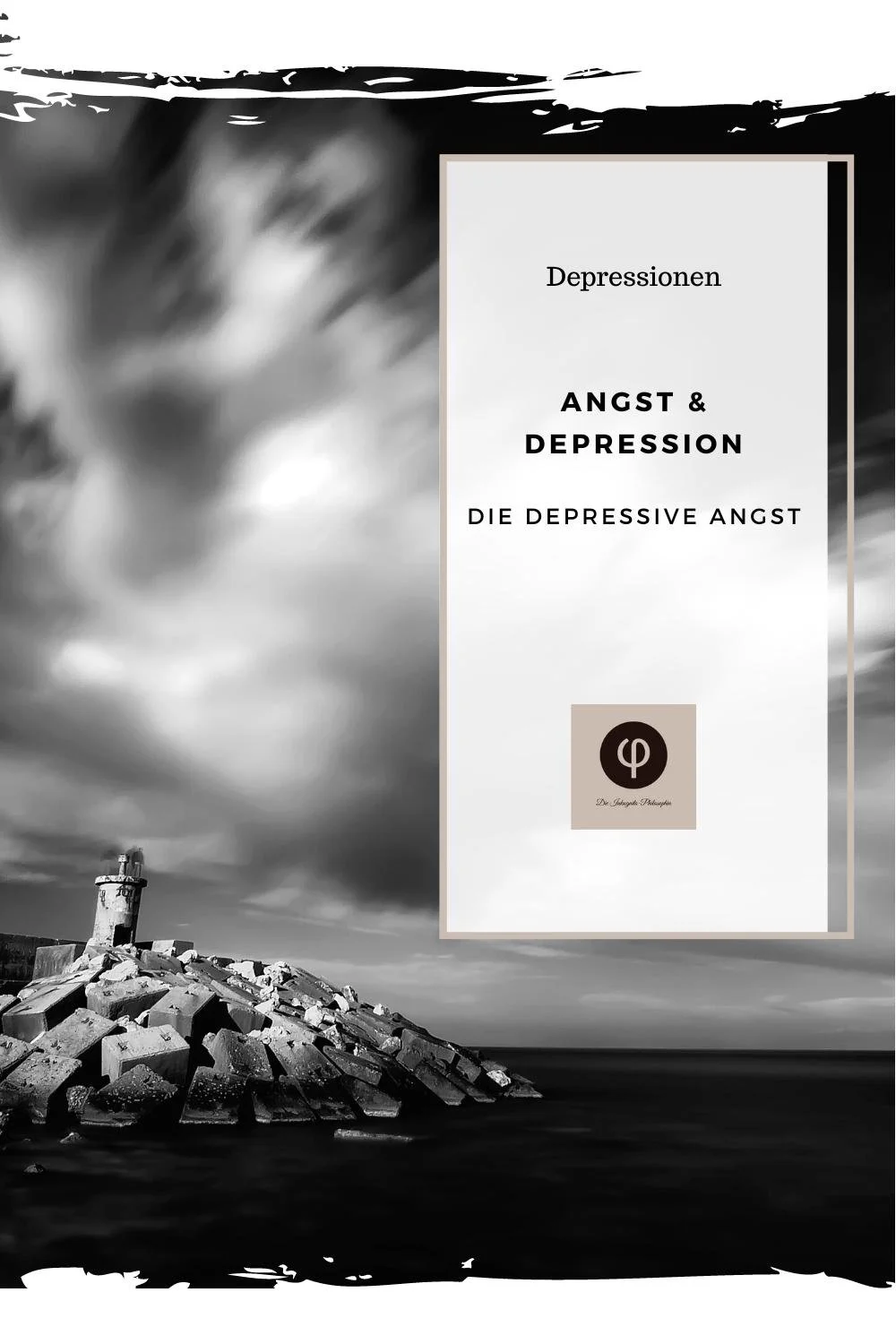Angst und Depression – Die depressive Angst
Angst in der Depression hat einen speziellen Charakter: sie ist allumfassend, gewaltig und extrem hemmend. Gerne wird sie (als existenzielle Krise) im Sinne der Existenzphilosophie als Chance zur Freiheit interpretiert. Es gibt aber auch andere Ansätze, die sie als Verlust verstehen.
Ängste durch Depressionen
Sind depressive Ängste ein Ausdruck von Daseinsängsten? Oder gibt es entscheidende Unterschiede zwischen der Angst in der Depression und einer Sinnkrise der Selbstwerdung?
Die Angst in der Depression
In vielen Fällen von depressiven Erkrankungen ist Angst im Spiel. Sie kann generalisiert, also unklar, diffus und nicht näher zu definieren sein. Oft zeigt sie sich als ein hintergründiges Gefühl von anhaltender Bedrohung.
In der Psychologie wird daher zwischen Realangst (Furcht vor Konkreten) und Existenzangst (Angst vor Unbestimmten) unterschieden, wobei man auf die veraltete philosophische Unterscheidung von Angst und Furcht zurückgreift.
Ob die terminologische Differenzierung von Angst und Frucht sowie Gefühl und Emotion sinnvoll und korrekt ist, ist allerdings heute zu Recht umstritten.
Richtig ist jedenfalls: In der Depression erhalten alle Dinge um mich herum und sogar Teile meines Selbst einen anderen Bezug, einen unsicheren, unheilvollen Charakter.
Gedanken, Erlebnisse und Begegnungen sind eingefärbt in eine bedrohliche, bedrückende Atmosphäre.
Der systemische Therapeut Jannis Puhlmann erklärt: “Dort, wo andere Möglichkeiten der Bedeutsamkeit fehlen, breitet sich die Möglichkeit der Bedrohung atmosphärisch in der Lebenswelt aus.” (7)
Vgl. auch In der Depression – Die Verfremdung der Lebenswelt
Welche Ängste haben Depressive?
Angst zur Arbeit zu gehen
Verlustangst
Angst vor Urlaub
Angst vor der Zukunft
Angst vor dem Leben
morgens Angst
Existenzangst
Angst vor Veränderung
Angst vor Krankheit
Todesangst
Angst vor depressiven Gedanken
Angst verrückt zu werden
Angst Nicht-zu-sein
Angst vor Ablehnung
Angst vor Menschen
Angst zum Arzt zu gehen
Angst vor dem Partner
Angst vor Verantwortung
Angst vor sich selbst
Angst vor Vereinsamung » vgl. Einsamkeit in der Depression
Angst, dass die Depression nicht weg geht
Angst vor der Angst
Angst vor Versagen
Angst vor allem
Angst vor der Sterblichkeit
Das Janusgesicht der Angst
Angst gibt es nicht nur in jeder Kultur, sie wird auch überall ähnlich konstant erlebt: vorwiegend als körperliches Engegefühl, Hemmung und Handlungsohnmacht. Andererseits kann Angst auch Energien freisetzen, die es zur Überwindung einer bestimmten Situation braucht.
Sowohl in der phänomenologischen als auch der existenziellen Philosophie kommt der Angst des Menschen eine Schlüsselposition für das Selbst zu.
Auch ist die Angst nach neuerer Philosophie intentional, sie bezieht sich auf etwas, völlig egal, ob es sich dabei um reale oder irreale Dinge handelt. Eine besondere Form der Angst des Menschen ergibt sich durch seinen Sinn für die Zukunft (Daseinsangst, Existenzangst).
Die Enge der Angst
Einige halten Angst für ein Grundgefühl, andere für eine allgemeine Stimmung. Wie auch immer ich sie definieren will, bereits der Wortlaut gibt Hinweise auf das leib-seelische Erleben von Angst beim Menschen.
Wortgeschichtlich ist der Begriff Angst verwandt mit:
indogermanisch *anghu = „beengend“
altgriechisch agchein = “würgen, drosseln, sich ängstigen”
lateinisch angor „würgen“ und angustus für „Enge, Beengung, Bedrängnis“
altindisch amhah = “Angst, Bedrängnis”
awestisch azah = die Kehle zuschnüren, das Herz beklemmen, Enge, Not”
Egal ob altgriechisch, keltisch oder altindisch – alle Begriffe, die mit Angst in sprachwissenschaftlicher Verwandtschaft stehen, sind mit der Bedeutung “eng, beklemmen” verbunden. Allein lautmalerisch drückt das gutturale “ang” bereits ein Abschnüren der Kehle aus.
Der leibliche Facette der Angst
Neben Jaspers, Sartre oder Kierkegaard werden auch neuere Philosophie-Konzepte herangezogen, um das (krankhafte) Angsterleben zu verstehen. Meist ist das die Neue Phänomenologie von Hermann Schmitz: Der Mensch spürt Gefühle leiblich als Engung bzw. Weitung oder Spannung bzw. Schwellung.
Dementsprechend interpretiert Schmitz die Angst als gehemmten Fluchtdrang. Das Enge-Erlebnis in der Angst ist sozusagen die Enge des Leibes, in welchem die aufgestaute Energie verzweifelt um Weite ringt, die sie nicht erhält.
Das Wovor der Angst findet sich nach Schmitz in der Gegenwart als solcher. Darüber soll sich das Subjekt aber nicht bewusst sein, es ist blind für die Entstehung seiner Angstgefühle.
Die Angst tritt auf, wenn man keinen Ausweg mehr findet und die Gefahr immer näher rückt. Die Furcht wird zur Angst, wenn eine unauflösbare Spannung zwischen Fluchtimpuls und Handlungsohnmacht entsteht.
Es geht um ein Nicht-loskommen von dem, was einschränkt (Körper, Katastrophengedanken).
Dabei wird die Angst vor allem räumlich-zeitlich und leiblich verstanden. Während die Furcht sich atmosphärisch ausbreitet (mitsamt Verdichtungsbereich und Verankerungspunkt), zeigt sich Angst vorwiegend in leiblichen Regungen.
Angst befällt oder packt plötzlich. Sie unterbricht damit jäh das Zeitgefühl und wirft den Menschen brutal auf die Gegenwart zurück.
Die Komplexität der Angst
Kritisiert wird an Schmitz’ Ansatz die leibliche Charakterisierung von Angst (1) und die Uneinheitlichkeit seiner Ausführungen. Stefano Micali bringt wesentliche Einwände auf den Punkt (3) und erinnert an andere typische Merkmale der Angst, wie Zittern, Schwitzen oder Herzrasen, die sich als Kontrollverlust (zentrifugale Bewegung) äußern:
Übergänge: Angst sei zwar ein starker Affekt, der das Bewusstsein beeinflusst, aber nicht mit kopfloser Panik gleichzusetzen.
Fantasie: Angst ist nicht ausschließlich leiblich, sondern nutzt immer kognitive Funktionen. Im Kopf entstehen Katastrophenszenarien und dramatische Bilder, welche die Angst noch verstärken.
Kognition: Angst gibt es in verschiedenen Abstufungen, so dass man sich durchaus im Klaren sein kann, was die Angst auslöst bzw. wem die Angst gilt.
Zeitlichkeit: Angst ist proleptisch, auf die Zukunft gerichtet. Mit Hilfe der Imaginationskraft werden zukünftige Situationen negativ vorweggenommen. Die Zukunft wirkt bedrohlich, unsicher und eindeutig negativ determiniert.
Identifikation: Micali betont, wie stark sich das Subjekt mit der situativen Angst identifiziert. Im Moment der Angst befindet sich das gesamte Selbst in Gefahr - vollständig und total.
Um das Phänomen der Angst zu erfassen, sind deshalb mehrere Dimensionen notwendig: subjektives Zeitempfinden, Fantasie, Wahrnehmungsverzerrung, Ohnmachtsgefühl etc.
Die Dialektik der Angst
Und das bedeutet ganz richtig, in der Angst geht es nicht nur um mein leibliches Erleben, es geht um die Veränderung meines Selbst- und Weltverhältnisses.
Bezeichnend ist hier die dialektische Bestimmung von Angst als einem Phänomen, das einerseits praktisch und rational (Wahrnehmung von Gefahren und Flucht), andererseits dysfunktional und irrational (Lähmung, Verwirrung, Ohnmacht) sein kann.
„Er schaute wieder das ernste Antlitz der mächtigen Frau, und die verstörende Angst des sehnsüchtigen Verlangens erfasste ihn aufs neue.“
Die Freiheit der Angst
Die wenigsten wissen, dass Angst in den verschiedenen Sprachen einen 2. Bedeutungsgehalt (6) hat, der nicht übersehen werden darf:
engl. anxiety bedeutet auch “Verlangen, Begehren”
ital. ansia steht ebenfalls für “Sehnsucht” und “Verlangen”
genauso wie das portug. ansiedade
Das passt ganz gut zu Kierkegaard, der in der Angst “die Wirklichkeit der Freiheit als Möglichkeit für die Möglichkeit” (2) sah. Freilich geht es hier um eine existenzielle Angst, die ein Mensch erfährt, wenn er sich seiner Möglichkeiten bewusst wird und gleichzeitig das Risiko darin erkennt.
Angst in der Existenzphilosophie
Das Interessante bei Kierkegaard ist, dass die Angst ambivalent ist: Sie schreckt ab und lockt gleichzeitig. Angst ist nicht nur ein belastendes Gefühl, sie ist auch anziehend (1). Er codierte die Angst doppeldeutig: als furchterregend & attraktiv, belastend & befreiend.
Ähnliches schwebte auch Sartre vor, der für seinen Ausspruch bekannt ist, der Mensch sei zur Freiheit verurteilt. Der Mensch ist in die Welt geworfen und muss sich selbst entwerfen – die Freiheit ist dem Menschen also inhärent, doch wird ihm meist erst in der Angst bewusst.
Im Existentialismus ist die Geworfenheit des Menschen in eine Selbstbezogenheit von zentraler Bedeutung. Jeder Mensch muss sich auf irgendeine Art und Weise eigenverantwortlich & allein entscheiden und handeln.
Doch erst in der Angst erlangt der Mensch ein Bewusstsein für seine Freiheit. Wie und wofür er sich entscheiden soll, weiß er nicht. Zwischen Wille und Handlung breitet sich ein Nichts aus, das ihn jäh von der Zukunft trennt. Diese Nichts ist es, das die existenzielle Angst als conditio humana begründet.
Heidegger “Sorge ums Dasein” & Jaspers “Angst Nicht-zu-sein”
Auch Heidegger geht in seinem großen Werk “Sein und Zeit” auf die Vorwegnahme des Nichts als ein “Vorlaufen zum Tode” ein, das der Einzelne brauche, um überhaupt seine Existenz verwirklichen zu können. Für Heidegger ist die Endlichkeit des Daseins ihrem Wesen nach Angst. Sie ist die Grundstimmung des Menschen, die sein Selbst- und Weltbild bestimmt.
Die Angst richtet sich umfassend und ganzheitlich auf das In-der-Welt-sein, auf die Welt an sich. Auf sich selbst zurückgeworfen hat der Mensch durch die Angst die Möglichkeit, sich von äußeren Zwängen zu lösen und sich auf seine individuellen Optionen zu besinnen.
Jaspers dachte sich wiederum jede Angst als Ausdruck von Todesangst: vitale Angst (Daseinsangst), die Angst nicht zu Überleben bzw nicht auf die richtige Art und Weise zu leben, gründet sich auf die existenzielle Angst (Existenzangst), die Angst im tieferen Sinne Nicht-zu-Sein bzw. ein Nichts zu sein.
Selbstverhältnis und existenzielle Angst
Interessant ist, dass der Existentialismus die Angst für notwendig ansehen, um zu einer tiefen, erfüllenden Daseinsweise des Selbst zu gelangen. Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit ist notwendig, um die Möglichkeiten der Freiheit überhaupt zu erkennen.
Gleichzeitig ist damit die Gefahr verbunden, in einen Nihilismus abzurutschen, der das Leben generell entwertet. Auf der anderen Seite steht der Gewinn, die Einzigartigkeit des Lebens wahrzunehmen.
„Wie immer das sein mag, es steht fest, dass das Angstproblem ein Knotenpunkt ist, an welchem die verschiedensten und wichtigsten Fragen zusammentreffen, ein Rätsel, dessen Lösung eine Fülle von Licht über unser ganzes Seelenleben ergießen müßte.“
Die depressive Angst als Ausdruck von Grundkonflikten?
Die Angst erhält nicht nur in der existenziellen Philosophie eine Schlüsselposition, sondern auch im Selbsterleben bei psychischen Erkrankungen, wie Angstkrankheiten oder Depressionen.
In der phänomenologischen Psychiatrie wird sie in Anlehnung an Schmitz als “Konflikt zwischen einer leiblichen Einengung und einem gegen sie gerichteten Fluchtimpuls” beschrieben (5). Auch die Ausweglosigkeit des Moments ist konstitutiv für das Angsterleben.
Nach diesem Ansatz ist die Angst von räumlicher Qualität: findet sie kein Objekt, deformiert sie den Umraum in eine unheimliche Atmosphäre. Zudem sind die Handlungsoptionen extrem reduziert, es bleiben nur Flucht oder Untergang.
Thomas Fuchs vermutet: “Hinter der Störung de Verhältnisses von Leib und Umraum (...) verbirgt sich dann ein tieferer, existenzieller Konflikt zwischen verschiedenen Lebens- und Beziehungsmöglichkeiten” (5)
Aber ist es wirklich diese existenzielle Angst vor Selbstwerdung, die sich mir in der Depression nähert?
Ich persönlich empfinde eher eine Art ängstlicher Verzweiflung über den sicheren Untergang, der unaufhaltsam auf mich zuschreitet. Sozusagen die Angst vor einer verfremdeten, leeren Welt, die mir tatsächlich keinerlei Wahl bietet.
Das ist ein großer Unterschied. Dann ist es nämlich nicht so, dass ich vor lauter Existenzangst eine depressive Angst ausbilde, sondern die Angst in der Depression führt mich unweigerlich zur Angst vor dem Nichtsein.
So würde es nämlich Ratcliffe in seiner Theorie der existenziellen Gefühle erklären. Der Hintergrundsinn des Depressiven verarmt, er kann bestimmte Bezüge und Möglichkeiten nicht mehr herstellen oder wahrnehmen. Statt Vertrautheit und Sicherheit erlebe ich überall um mich herum Fremdheit - und das macht selbstverständlich existenziell Angst im Sinne von realer Todesangst. Hier auf Grundkonflikte zu verweisen, scheint mir persönlich nicht der richtige Ansatz.
Pathogene Angst als nicht akzeptiertes Leiden?
Eine etwas andere Deutung bietet Alice Holzhey-Kunz (9), die einen Unterschied zwischen Angstsymptomen, als Leiden an der Angst, und der Angst als philosophische Erfahrung macht. Sie gibt an, Gadamer zu folgen, wenn sie Erfahrung mit freiwilligem Anerkennen, Integrieren und Akzeptieren des Leides assoziiert.
Hinter dem Leiden an den Angstsymptomen (Verweigerung des Leides) soll sich dann aber die philosophische Selbsterfahrung verbergen. Betroffene sollen außerdem eine besondere Hellhörigkeit gegenüber oberflächlichen Sinndeutungen besitzen, die anfällig für Angst macht.
Pathogene Angst als besondere Fähigkeit ist eine sehr idealisierte Sichtweise. Auch einen inneren Widerstand kann ich nicht als Ursache nachvollziehen.
Warum wird “leiden” mit einem Festhalten am Schmerz bzw. Uneinsichtigkeit gleichgesetzt?
Laut Wortgeschichte gibt es Unterschiede:
Das Substantiv Leid ist etymologisch nicht mit dem Verb leiden verwandt. Leid geht auf die Bedeutung "Frevel, Widerwille, Böses tun, Schmerz, Sünde" zurück.
Das Verb leiden stammt dagegen von „weggehen; fahren, reisen“; im weiteren Sinne „durchmachen, durchstehen (also erleiden), dahingehen, sterben“ (10).
Wenn ich also an depressiver Angst leide, dann bedeutet das nicht zwingend, dass ich abwehre oder mich widersetze.
Im ursprünglichen Sinne bezeichnet das Verb “leiden” (an der Angst oder etwas anderem) einen Prozess: ich begebe mich auf den Weg und stehe Widrigkeiten durch, die mir notwendigerweise auf jeder Reise begegnen.
Die depressive Angst als Möglichkeitsverlust
Nach phänomenologischen Ansätzen in der Psychiatrie bewegt sich der Mensch grundsätzlich zwischen Polaritäten (Leib - Körper, subjektive Zeit - objektive Zeit, Selbst - Andere), die konstitutiv für sein Menschsein sind.
Gerade bei seelischen Krankheiten wirkt es aber so, als verselbständigt sich ein Pol. Die Angst würde in diesem Sinne auch ihre Doppeldeutigkeit verlieren: die Möglichkeit zur Freiheit fällt weg, übrig bleibt nur der Fall in die Sinnlosigkeit.
Das ist aber nichts, das direkt in meinem Willen liegt.
vgl. auch: Depression: gestörtes Zeitgefühl – Zeitverlust oder Stillstand sowie Depression: körperliche Anzeichen – Korporifizierung des Leibes
Ratcliffes Theorie der existenziellen Gefühle
Der Philosoph Daniel Ratcliffe weist auf einen Phänomenbereich hin , der in der Emotionsforschung gerne vernachlässigt wird: den veränderten Weltbezug als Basis von jeder Art emotionaler Rahmen bzw. Grundstimmung: existenzielle Gefühle (11).
Normalerweise basieren Wahrnehmung, Bewertung, Gefühle, Gedanken und Verhalten auf einer grundlegenden Vertrautheit mit den Dingen, Menschen und Situationen.
Ich habe grundsätzlich ein Einheitsgefühl bzw. ein vages Verbundenheitsgefühl von Selbst und Welt. Erfahrungen sind durch diese prä-reflexiven existentiellen Gefühle überhaupt erst möglich.
Das bedeutet:
Ich erlebe je nach existenzieller Stimmung die Welt und mich unterschiedlich.
Und habe dadurch auch jeweils andere Bewertungs-, Denk- und Handlungsmöglichkeiten
Angst als existenzielles Gefühl in der Depression
In der Depression kommt dieses basale Grundvertrauen abhanden. Die Welt wirkt auf mich hintergründig, irgendwie irreal, seltsam fremdartig und distanziert. Ich fühle mich von allen Beziehungen entfremdet, auf eine tiefgründige Art und Weise abgeschnitten.
Wenn die Angst als existenzielles Gefühl bzw. Stimmung auftritt, dann verformt sie den wahrnehmbaren Umraum des Subjekts (vgl. Fuchs). Um das Ganze verständlicher zu machen, wird oft das Beispiel eines dunklen Waldes genannt. Darin zeigt sich, wie existentielle Gefühle sich nicht von leiblichen, subjektiven und umweltbezogenen Aspekten entflechten lassen.
Ein dunkler Wald wirkt als bedrohlich-unheimliches Szenario. Es lässt sich nicht an etwas Konkretem festmachen, vielmehr ist es die ganze Synästhesie des dunklen Waldes, die den subjektiven Erlebnisraum beherrscht.
Sich in diesem dunklen, bedrohlichen Wald zu bewegen, lässt sich nicht ohne eine subjektiv empfundene Angst vorstellen.
Wahrnehmung, Denken, Gefühle, Handeln, Möglichkeiten – alles steht unter der Perspektive der existenziellen Angst, die in diesem Szenario erlebt wird.
Typischerweise manifestiert sich die Stimmung an Konkretem: Schatten, schemenhafte Gestalten, undefinierbare Geräusche in der Dunkelheit sind Elemente, welche die existenzielle Stimmung der Angst verdichten.
Existentielle Gefühle sind keine gewöhnlichen Stimmungen, sondern der grundlegende Rahmen und Zugang zu meinem Erfahrungsfeld.
Sie sind so fundamental mit meinem Selbst- und Weltbezug verwoben, dass es von ihnen abhängt, welche Erfahrungsdimensionen sich mir erschließen.
Andererseits öffnen existenzielle Stimmungen nicht nur Freiräume, sie können mir auch Erlebenshorizonte erschweren oder verschließen.
Formen der depressiven Angst
Vor diesem Hintergrund werden auch die verschiedenen Formen der Angst in der Depression verständlicher. Je nach Individuum ergeben sich so unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Verdichtungsbereiche der Angst.
Angst- & Panikattacken (vitale Angst)
Angstanfälle, die ohne erkennbaren Anlass auftreten (8 ), sind nichts Ungewöhnliches bei Depressionen. Typische Beispiele sind Panikattacke bei der Fahrt auf der Autobahn, Angstzustände in der Nacht oder soziale Ängste mit starken Unruhephasen.
Da die existenzielle Angst in der Depression auf nichts intentional ausgerichtet sein soll, also keinen konkreten Bezug hat, lässt sich keine objektive Ursache für die Panik finden. Ich kann nicht immer sagen, was mir so extreme Angst macht und warum ausgerechnet jetzt.
Vielleicht ist die Angst aber dann doch intentional. Schließlich habe ich eine unterschwellig fremdartige Wahrnehmung von meiner Umwelt. Ich bin hier nicht sicher. Ich bin nirgendwo sicher - nicht unter Menschen und nicht bei mir selbst.
Vielleicht spielen aber auch die leiblichen Missempfindungen hier eine Rolle. Ich kann meinem eigenen Körper nicht mehr vertrauen, so fremd und unberechenbar fühlt er sich an.
Lebenswichtige Funktionen (Atmen, Gleichgewicht etc) sind seltsam gehemmt - als würden die Organe kurz vor dem Kollaps stehen. Oder das Herz schmerzt, als würde ein Stein es (zer)quetschen.
Wie zum Teufel sollte ich da ohne Angst sein?
Angst vor der Zukunft
Zukunftsangst bedeutet Angst vor dem kommenden Ungewissen. In der Depression macht diese Angst die Relevanz der Zeitlichkeit für den Menschen deutlich. Der Zukunftsbezug ist auf dem Boden der Angst eingeschränkt und extrem negativ geprägt. Doch Angst vor der Zukunft ist keine Unsicherheit.
Die Zukunft, das Noch-nicht, bietet mir nichts. Sie ist schon determiniert durch meine leidvolle Erfahrung der Gegenwart. Eine Zukunft kann ich mir höchstens in einer gesteigerten Negativität vorstellen.
Es gibt nur leidvolle Risiken, die mir aufgezwungen werden – sonst nichts. Ich habe keine Wahl zwischen Alternativen.
In diesem Sinne verfolgt mich nicht die Angst, Möglichkeiten zu verpassen oder mich falsch zu entscheiden oder an der Ungewissheit zu verzweifeln. Mich ängstigt die vermeintliche Gewissheit (Erwartungsangst), zu den negativen Visionen, die mir vorschweben, verdammt zu sein. Und das immer in Abhängigkeit von der unberechenbaren, verfremdeten Welt, in der ich mich befinde.
Angst vor dem Leben
Angst vor dem Leben steht eigentlich für eine ganze Reihe von Sorgen: soziale und finanzielle Sicherheit oder Angst, die Anforderungen des Alltags, des Berufs und des Lebens nicht meistern zu können (vgl. Versagensangst).
Auch hier lässt sich die pessimistische Haltung in der Depression besser verstehen, wenn ich den ver-rückten Ausgangspunkt berücksichtige, von dem ein Betroffener ins Leben blickt.
Die Welt, die Menschen und ein Leben darin scheinen mir unmöglich. Es gibt nichts Vertrautes mehr unter der Sonne. Welt und Mitmenschen sind mir entrückt, nichts davon ist mir noch greifbar. Eine Zukunft kann ich mir nur negativ vorstellen.
Auch hier ist es nicht das mögliche Risiko, das ich fürchte. Es ist der sichere Untergang, auf den sich meine Verzweiflung richtet.
Angst vor Veränderung
Positive Veränderungen lassen sich in einer Depression kaum mehr vorstellen. Es existiert nur die Bewegung abwärts, in die Verschlimmerung. Im Grunde ist die Angst vor Veränderung eine Form der depressiven Zukunftsangst. Alles, was ich mir vorstellen kann, sind negative Wendungen und Ereignisse.
Zudem sind Veränderungen für Depressive anstrengend. Sie wirken wie ein Störfaktor, die mich unendlich viel Kraft kosten. Sie fordern, was ich nicht (mehr) kann: Initiative. Kontrolle. Leben.
Angst vor Krankheit (hypochondrische Angst)
Wandelt sich der Leib in einen unbequemen, gefühllos und starren Körper, der sich chronisch durch Schmerzen oder Unwohlsein bemerkbar macht, liegt der Gedanke nicht fern, an einer körperlichen Krankheit zu leiden bzw. gerade im Begriff zu sein, eine Krankheit auszubilden.
Was soll ich auch sonst davon halten, wenn mir mein Leib als unvertrautes, negatives Fremdes gegenübertritt und mir den Weltbezug verwehrt anstatt ermöglicht?
Zurückgeworfen auf mich selbst, wird das Körperempfinden überdeutlich spürbar - wächst in seiner Unnatürlichkeit und Bedrohlichkeit überdimensional an.
So wird mir jedes Herzstolpern, jede Atemnot, jedes noch so kleine Körpergefühl zum möglichen Vorboten oder Zeichen einer (tödlichen) Krankheit.
Angst vor depressiven Gedanken
Ein Zeichen der Selbstentfremdung ist die Angst vor den eigenen Gedanken in der Depression. Das Denken verselbständigt sich, verläuft sich ins Negative, drängt und droht – als hätte es ein Eigenleben entwickelt.
Anklagende Gedankenkreise beherrschen Tage und rauben den Schlaf. Machen teilweise sogar Angst vor der Nacht.
Die sinnlosen Aneinanderreihungen und heftigen Selbstvorwürfe kosten mich gefühlt ein weiteres Stück Lebenskraft. Teilweise können diese Gedanken auch so aggressiv und gehässig werden, dass ich unheimliche Angst vor mir selbst bekomme. In ihnen drückt sich eine Selbstfeindlichkeit aus, die mich zutiefst erschüttert.
Soziale Ängste in der Depression
Gedanken, Emotionen, Körper – mein ganzes Selbst ist ein tiefes Gefühl von Getrenntheit und Entfremdung eingebettet. Zu anderen Menschen lässt sich nur noch schwer eine empathische Verbindung herstellen. Die Menschen sind zwar immer noch dieselben, aber ich bin irgendwie abgeschnitten von ihnen.
Ich fühle eine Distanz zu den anderen, die sich mir unmittelbar bei jeder Begegnung schmerzlich aufdrängt. Allein das macht Angst.
Hinzu kommen Schamgefühle (Schamangst, Angst vor Menschen) und Angst vor Ablehnung.
Zum Beispiel kann ich Angst vor dem Einkaufen im Supermarkt haben oder Angst vor dem U-Bahn Fahren – Situationen, in denen ich unweigerlich anderen Menschen begegne und die mich allein mit ihren Blicken in meiner Andersartigkeit entlarven könnten (vgl. Angst vor Blicken).
Angst verrückt zu werden
Wer mit einer Depression kämpft, kommt unweigerlich an diesen Punkt. Alles ist meinem Einfluss entzogen - ich habe keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Ich kann nicht mehr.
Körperlichen Empfindungen und Gedanken versinken im Chaos aus Übererregung und Betäubung – Teile von mir verselbständigen sich und wenden sich gegen mich.
Hier geht es nicht um ein verbissenes Festhalten an Kontrolle, wie manche Psychotherapeuten irrtümlich annehmen. Bei Depressionen geht es um ein basales Vertrauen in mein Selbst, das zutiefst erschüttert ist. Körper, Gedanken, Gefühle, Weltzugehörigkeit, meine Beziehungen – alles, was mich trägt und ausmacht, ist verloren gegangen.
Fazit: Depressive Angst
In der Depression habe ich allen Grund dazu, Angst zu empfinden. Meine Gedanken, Gefühle und mein Leib sind mir allesamt unheimlich und fremd.
Die Welt wird mir unvertraut, ich kann mir ihre Bedeutungen nicht mehr erschließen. Alles wirkt so surreal und irgendwie falsch, dass ich mich grundsätzlich bedroht fühlen muss.
Auch, weil mein Selbstverhältnis damit aufs engste verschränkt ist.
Evtl. interessant für dich:
Panikattacke: Nachwirkungen – Symptome danach
Quellen:
1) C. Demmerling und H. Ladweer: Philosophie der Gefühle. Metzler, 2007
2) Kierkegaard: Der Begriff der Angst, Reclam 1992
3) S. Micali: Negative Zukunft. Eine phänomenologische Analyse der Angst. In: Selbst und Selbststörungen. Schriftenreihe der DGAP, Bd. 8, Verlag Karl Alber, 2020
4) Hermann Schmitz: Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, Verlag Karl Alber, 2009
5) T. Fuchs und S. Micali: Die Enge des Lebens. Zur Phänomenologie und Typologie der Angst. In: Angst. Schriftenreihe der DGAP, Bd. 6, Verlag Karl Alber, 2017
6) N. J. Bettlé: Das Wort Angst. Auf www.angst-geschichte.com, abgerufen am 02.12.2022
7) J. Puhlmann: Lebenswelt und Depression, Beck 2019
8) Schattendasein: Das unverstandene Leiden Depression
9) A. Holzhey-Kunz: Angst als philosophische Erfahrung und als pathologisches Symptom. In: Angst. Schriftenreihe der DGAP, Bd. 6, Verlag Karl Alber, 2017
10) Conrad Horst: Etymologie-Info. Auf www.wortherkunft.de, abgerufen am 08.12.2022
11) Christian Tewes: Existenzielle Angst und ihre Verkörperung. In: Hermeneutische Blätter, 26(1+2), 37–52