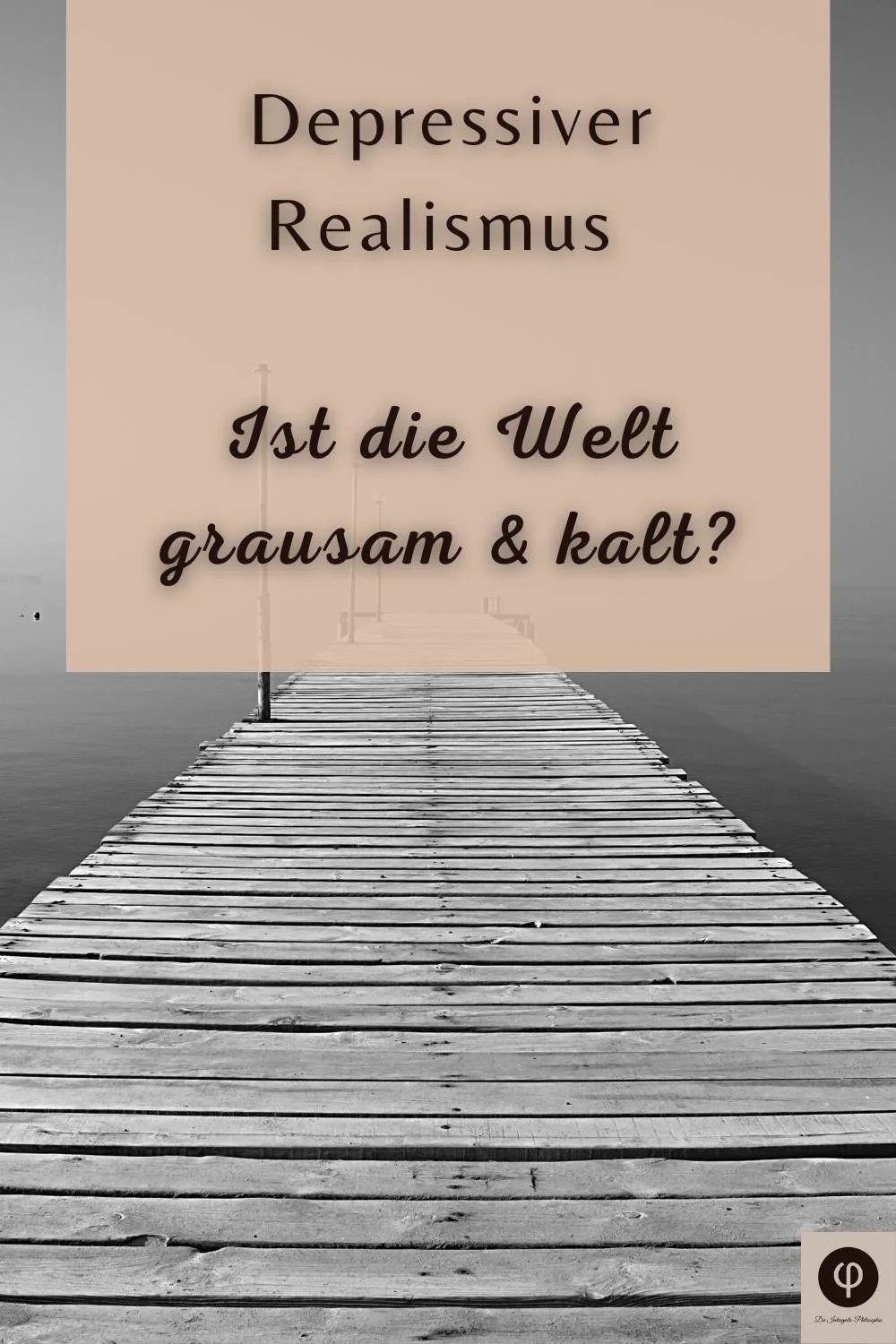Depressiver Realismus – Sehen Depressive die Welt nüchtern?
“In meiner Depression lernte ich die dunkle Seite der Welt kennen, über die ich vorher wenig wusste. Ich konnte Leid und Wahn nicht länger ignorieren und öffnete ein neues Fenster zur Realität (…) Was ist, wenn die Realität wirklich scheiße ist und wir, während wir deprimiert sind, genau die Illusionen verlieren, die uns helfen, dies nicht zu erkennen?“ (Reshe, Quelle 3)
Die depressive Wirklichkeit
Depressive sehen die Welt negativ, gesunde Menschen optimistisch. Doch was liegt näher an der Wirklichkeit?
Depressionen, Wahrnehmung & Weltsicht
So schrieb die Philosophin Julie Reshe über ihre Depression.
Und sie ist nicht die einzige, die in der depressiven Weltsicht eine Wahrheit erkennen will, zu der gesunde Menschen keinen Zugang hätten. Selbst historische Geistesgrößen wie Virginia Woolf und Friedrich Nietzsche meinten, die Depression eröffne Ihnen einen besonderen Freiraum.
Was ist da dran? Schließlich gibt es wirklich Untersuchungen, die nahe legen, dass leichte bis mittelschwere Depressionen zu einer genaueren Beurteilung von Geschehnissen, der eigenen Fähigkeiten & Grenzen beitragen können.
Der depressive Realismus stellt das Grundkonzept der Psychologie auf den Kopf
Wenn wir diesen Ansatz in Gedanken weiter verfolgen, dann kommen wir auf philosophisches Terrain.
Sehen Depressive die Welt, wie sie wirklich ist?
Sind Depressionen gar keine Krankheit, sondern eine normale Reaktion auf die Grausamkeit der Welt?
Ist es besser, die Welt depressiv zu sehen anstatt “rosarot”?
Was ist depressiver Realismus?
Die Hypothese des depressiven Realismus besagt, dass Du als Mensch mit Depressionen eine klarere, nüchterne Vorstellung & Wahrnehmung davon hast, wie die Dinge & Menschen wirklich sind.
Du sollst daher auch realistischere Entschlüsse treffen können als „normale“ Menschen.
Es geht aber noch weiter: der depressive Realismus ist eine Weltanschauung der menschlichen Existenz, die im Wesentlichen negativ ist und die Annahmen über den Wert des Lebens in Frage stellt.
Der depressive Realist erkennt die kalte Welt
Der Begriff „depressive realism“ wurde 1988 von 2 amerikanischen Psychologen eingeführt: Lauren Alloy und Lyn Yvonne Abramson (Depressive Realism: Four Theoretical Perspectives).
Sie und einige andere Experten wie auch Betroffene glauben, die negativen Gedanken bei Depressionen spiegeln eine genauere Sicht auf die Welt wider.
So konstatiert der Mediziner Frank Sacco: „Schopenhauer war ein Realist und zwar paradoxerweise ein Realist wahrscheinlich ohne eine ihn dominierende Depression. Endogen Depressive sind ebenfalls Realisten. Sie sehen diese Welt bzw. diese Erde in ihrer ganzen Grausamkeit.“ (2)
Hintergrund: das Pollyanna Prinzip
Der Name Pollyanna-Prinzip stammt aus dem gleichnamigen Roman von Eleanor H. Porter. Die Hauptfigur ist ein junges Mädchen, das versucht in jeder Situation etwas zu finden, worüber es sich freuen kann.
Studien belegen, dass Nichtdepressive – also die meisten Menschen – die Welt positiv einschätzen. Allerdings einen Ticken positiver als sie ist.
Menschen tendieren stark dazu, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit einer „rosaroten“ Brille zu beurteilen.
Diese allgemeine Art von positiver Voreingenommenheit nennt man „Pollyanna-Prinzip“: angenehme Ereignisse bleiben lebhafter im Gedächtnis haften als unangenehme.
Die Psychologie geht heute davon aus, dass Depressionen zu kognitiven Verzerrungen führen. Die Dinge werden überaus negativ verzerrt interpretiert.
Der depressive Realismus stellt diese These auf den Kopf und behauptet viel mehr, der allgemeine Optimismus des Menschen führe zum Leiden.
Der philosophische Pessimismus
Was ist der philosophische Pessimismus?
Ansicht, dass das Böse in der Welt das Gute überwiegt und Leiden viel intensiver ist als die Freude.
Der philosophische Pessimismus ist nicht neu. Schon mehrere Herren hatten die Idee, dass die Realität wesentlich grausamer ist, als sie den meisten erscheint.
Schopenhauer wird häufig als Urtyp des depressiven Realisten angesehen. Dabei ist er längst nicht der einzige Philosoph, der sich für die Nichtigkeit & Freudlosigkeit des Daseins ausspricht.
Arthur Schopenhauer – Die Nichtigkeit des Seins
Schopenhauer ist der Philosoph schlechthin, der diese Position vertritt: Er vergleicht das Leben mit „einem Pendel, das zwischen Schmerz und Langeweile hin- und herschwingt“ oder mit „einem Geschäft, das die Kosten nicht deckt“. Gegen den Optimismus von Leibniz setzt er die Überzeugung, wir lebten in „der schlechtesten aller möglichen Welten“
Laut einigen Experten war Schopenhauer deutlich depressiv & angstgestört. Er musste viele Techniken zur Selbsttherapie anwenden, um seine psychischen Symptome einigermaßen in den Griff zu bekommen.
Philipp Mainländer – Der Tod als Ziel des Lebens
Philipp Mainländer (1841-1876), ein Fan Schopenhauers, beklagt die Wertlosigkeit des Lebens und postuliert, Nichtsein sei besser als Sein.
Nach ihm liegt die wahre Befreiung und das Ziel jeden Lebens im Tod, der ganzheitlichen Vernichtung. Auch Mainländer zeigt in seinen Schriften und Aufzeichnungen typische Symptome von Depressionen.
Martin Heidegger – Angst als Existenzform
Auch Kierkegaard, Sartre oder Heidegger werden gerne ins Feld geführt. Martin Heidegger (1889-1976) bezeichnete die Angst als eine Grundform der menschlichen Existenz.
Das wahre Leben offenbart sich nur in der Angst. Im Moment der Angst werden wir uns selbst bewusst und können anfangen, frei zu denken und die Illusion, die uns die Gesellschaft auferlegt hat, durchschauen.
Peter Wessel Zapffe – das überentwickelte Bewusstsein
Der Norweger Zapffe (1899-1990) stellte folgende These auf: Das menschliche Bewusstsein sei auf tragische Weise überentwickelt, was zu existenziellen Ängsten (Existenzängste) führe.
Die Menschen hätten unerfüllbare Bedürfnisse entwickelt, weil die Natur selbst bedeutungslos geworden ist. Zum Überleben müsse die Menschheit diesen schädlichen Bewusstseinsüberschuss verdrängen.
Lauren Berlant
Relativ bekannt wurde die Theorie der Kulturtheoretikerin Lauren Berlant (22). Sie sieht die Depression nicht nur als Pathologie einer Gesellschaft, sondern als kritisches Moment innerhalb der Vorstellung vom gemeinsamen Leben.
Diese Spannung zwischen Wunsch & Realität soll erst den Freiraum eröffnen, den wir Menschen zum kritischen Hinterfragen benötigen.
Sehen Depressive die Welt klarer?
Sprechen die Philosophen davon, dass die menschliche Existenz an sich nichtig sei, sehen Depressive das eigene Leben für einen Sinnfehler an.
Es ist schon auffällig, dass sich philosophischer Pessimismus & depressive Weltsicht fast gleichen.
Aus dieser Annahme heraus, wirkt die Depression nicht mehr wie eine persönliche Psychische Krankheit.
Im Gegenteil! Die Philosophen würden zustimmen:
die Welt ist nunmal verkorkst,
viele soziale Normen sind krankhaft,
existenzielle Depressionen bei Hochbegabten sind typisch, weil sie mehr von der Welt erkennen.
Und dass ein Depressiver Angst, Sinnlosigkeit und Verzweiflung verspürt, wäre auch nur eine normale, menschlich Reaktion von jemanden, der über eine besonders sensible Aufmerksamkeit & Intelligenz verfügt.
„Der phänomenologisch Gesunde wird durch einen Trick der Natur in einen „künstlichen“ chemisch bedingten Glückszustand, in eine Art künstliche relative Manie versetzt.
Die Fröhlichkeit eines Gesunden ist ein „Kunstprodukt“, bzw. ein Trick der Natur. Man kann auch behaupten, dass durch einen Kunstgriff der Natur es einem Naturwesen erst möglich wird, in einer anders nicht aushaltbaren Natur zu überleben.“ (2)
Pro depressiver Realismus
Diese Studien zeigen Depressive als Realisten
Die Idee des depressiven Realismus ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass sich leichte und mittelschwere Depressionen möglicherweise positiv auf kognitive Prozesse auswirken. Allerdings gibt es beim genauen Hinsehen, doch wieder Ungereimtheiten zu entdecken, welche diese Ergebnisse in Frage stellen.
1) Traurigkeit fördert kritisches Denken
1984 erschien erstmals eine Studie zum Thema (10). Sie fand heraus, dass ein gewisser Grad von Traurigkeit dabei half:
Vorurteile zu reduzieren
die Aufmerksamkeit zu verbessern
die Ausdauer zu erhöhen
einen skeptischeren, detaillierteren und aufmerksameren Denkstil einzunehmen
Dagegen schienen glückliche Menschen zu Stereotypen & Klischees zu neigen.
2) Depression fördert analytisches Denken
Andere Forscher möchten in Depressionen keine Anpassungsstörung, sondern eine weiterentwickelte, evolutionäre Anpassung sehen (11). Die Funktion der Depression läge demnach darin, das analytische Denken zu fördern, um bei der Lösung komplexer psychischer Probleme zu helfen. Depressives Gedankenkreisen sind bei diesem Ansatz also ein Problemlösungsmuster (21).
Vgl. auch: Depression als Schutzmechanismus?
3) Depressive haben genauere Einschätzung
Tatsächlich hat sich auch herausgestellt, dass Depressive Menschen eine realitätsnähere Selbsteinschätzung unter bestimmten Bedingungen an den Tag legten (12). Um das zu evaluieren, wurden Selbstberichte der Teilnehmer als Schwerpunkt genutzt (4).
Depressive scheinen auch den Emotionsausdruck von Gesichtern um einiges besser wahrzunehmen und genauer einzuschätzen als Nichtdepressive (14).
Contra depressiver Realismus
Depressive sind krankhaft pessimistisch
Ist die Welt wirklich so ein kalter, grausamer Ort? Was ist denn die Wirklichkeit? Ist es besser depressiv-pessimistisch anstatt optimistisch-motiviert zu sein? Wenn ja, warum?
Da kommen eine Menge Fragen auf, die nicht einfach so zu beantworten sind. Hier nur ein paar Argumente gegen den depressiven Realismus…
1) Depressionen stören kognitive Prozesse
So viele Studien es auch gibt, die Depressionen einen höheren Realitätssinn zusprechen, so viele Gegenbeweise gibt es auch. Denn viele andere Forschungen belegen, dass Depressive einer stark verzerrten Wahrnehmung unterliegen und kognitive Prozesse nicht mehr richtig ablaufen können (6).
Um nur ein paar Beispiele zu nennen:
Depressive haben eine reduzierte visuelle Kontrastwahrnehmung (15), sehen also buchstäblich anders, was in Wechselbeziehung zum Denken steht.
Betroffene haben eine stark verminderte Reaktion auf Belohnung (16). Auf psychischer Ebene sind angenehme Gefühle stark vermindert, ebenso wie Motivation & Handlungfähigkeit.
Depressiven wurde ein größeres Angstzentrum (Amygdala) im Gehirn (17) nachgewiesen, was mit mehr ängstlichen, misstrauischen & pessimistischen Stimmungen zusammenhängt.
Ebenso ein verkleinerter Hippocampus, der eine zentrale Rolle für Gedächtnis, Lernen & Emotionen spielt (18), die bei Depressionen gestört sind.
Kürzlich bei Depressionen entdeckt: Störungen in der Blut-Hirn-Schranke (19), die das Gehirn vor Fremdstoffen schützten muss.
Eine schlechtere Stimmungsregulation, wie sie gesunde Menschen aufweisen (20)
2) Positive Studienergebnisse entspringen Kategoriefehlern
Kritik gibt es auch an den Studien, die positive Auswirkungen von Depressionen allein mit positiven Illusionen abgleichen. Nur diesen eng begrenzten Bereich zu untersuchen, ist nicht gerade aussagekräftig.
Der amerikanische Philosoph Hayden findet ein anschauliches Beispiel:
In Deutscher Übersetzung:
Lassen Sie mich den Unterschied veranschaulichen. Die meisten Menschen halten sich für überdurchschnittliche Autofahrer.
Wenn eine depressive Person sich selbst als durchschnittlich einstuft, ist sie dann richtig oder hebt ihr Pessimismus ihren Optimismus auf?
Wenn Sie nur positive Illusionen betrachten (wie zum Beispiel überdurchschnittliches Fahren), gibt es keine Möglichkeit, dies zu wissen.
Und da die klassische Literatur zum depressiven Realismus aus dem Studium positiver Illusionen hervorgegangen ist, ließ die erste Ergebnisrunde den Eindruck erwecken, dass depressive Menschen einfach genauer sind. (13)
3) Positive Studien mit vielen Methodikfehlern
Mal abgesehen von den bisherigen Argumenten, beinhalten die gleichen Studien, die für den depressiven Realismus sprechen möchten, einige Ungereimtheiten, die das Ergebnis stark verfälschen.
Zum Beispiel
wurde der Schweregrad der Depression nicht berücksichtigt, was großen Einfluss auf Selbstbild & Selbstwirksamkeitserfahrungen hat.
Populationsunterschiede scheinen in den Studien eine wichtige Rolle für die positiven Ergebnisse zu spielen. Als Versuchspersonen mit geringen Depressionswerten wurden fast immer Studenten untersucht, während Probanden mit schwereren Depressionen zumeist Patienten außerhalb des universitären Kontextes waren.
Meta-Analysen zeigen: die Unterschiede im Realitätssinn sind ziemlich gering (1). Wurden die Ergebnisse also überinterpretiert?
4) Depressionen verzerren das Selbst- & Weltbild ins Extreme
Die Hypothese des depressiven Realismus steht diametral meiner Selbstempfindung als Betroffene gegenüber.
Bei mittelschweren bis schweren Depressionen erleben ich und andere Depressive, eine völlig absurde Verschiebung der Realität ins Negative.
Und zwar einer krankhaft verzerrten feindlichen Realität, wenn ich in eine depressive Phase rutsche.
Depressionen halten Dich in einer egozentrierten Perspektive gefangen
Als Depressive*r bist Du Dir sicher, dass Du ein*e Versager*in bist, wertlos und ungeliebt. Das Leben und alles andere verlieren an Bedeutung. In Deinen Gedanken offenbart sich ein Selbsthass, der Dich entsetzt.
Erfahrungen werden in der Regel negativ interpretiert. Subjektiv erlebst Du zum Großteil Enttäuschungen und Niederlagen.
Deine Bewertung der Vergangenheit wird im Kontext von Scham, Schuld & persönlichem Scheitern verortet. Die Gegenwart erscheint unveränderlich, unbeeinflussbar & erdrückend.
5) Notwendigkeit der Lebensbejahung
In den allermeisten Fällen, kommst Du aus einer Depression nicht allein heraus. Nicht selten kommt es neben Selbstmordgedanken auch zum Suizid.
Gehen wir jetzt mal von Gestalten wie Schopenhauer weg, dann ist das beim philosophischen Pessimismus anders. Hier geht’s nicht um die Hingabe in eine schmerzvolle Verzweiflung bis zur Auslöschung.
Große Denker wir Nietzsche, Kierkegaard oder Camus haben eine aktive Teilnahme am Leben befürwortet, um sich aus der Verzweiflung des Daseins zu befreien.
Und auch im Buddhismus, in dem die Sinnlosigkeit der irdischen Welt eine zentrale Rolle spielt, geht es um Güte und Verbundenheit. Vor allem auch zu den Mitmenschen.
Update von 2022:
Studie kann depressiven Realismus nicht reproduzieren
Inzwischen ist wieder eine Studie zum Thema erschienen, welche den Ansatz wiederlegt. Quelle: Collabra:Psychology (2022). DOI: 10.31234/osf.io/xq24r
Fazit: depressiver Realismus
Den depressiven Realismus gibt es als psychologische Hypothese, wonach Depressive die Welt & Menschen klarer, genauer & nüchterner wahrnehmen. Diese Idee gründet aber auf falschen Infos.
Im Gegensatz zu einem Philosophen, der einer pessimistischen Weltsicht anhängt, sind Menschen mit depressiver Störung in ihrer Wahrnehmung & Urteilsfähigkeit stark eingeschränkt.
Der große Unterschied zwischen der depressiven Weltsicht, die sich im weiteren Sinne auch als depressiver Realismus beschreiben lässt, und einer pessimistischen Philosophie ist die Antwort auf die Frage:
Wie gehen wir mit Leid, Ungerechtigkeit & Not um?
Ein Depressiver ist gefangen in sich selbst, gefühlstaub, resigniert & verkümmert mit der Zeit
Ein philosophischer Pessimist hat die Freiheit, sein Leben selbstbestimmt zu führen, kann Freuden finden & empfinden, verzweifelt nicht am Dasein
Vgl. Philosophie und Psychologie – Vgl. auch: Was ist Philosophie?
Quellen:
1) Sam Woolfe: Philosophical Outlook & Mental Well-Being
2) Frank Sacco: Schopenhauer zwischen Depression und Manie
3) Julie Reshe: Depressive realism – We keep chasing happiness, but true clarity comes from depression and existential angst. Admit that life is hell, and be free
4) Wikibrief: depressive realism
5) Neel Burton: Depressive realism
6) Stefan Krause: Sadder but wiser – Zum Realismus der Selbsteinschätzung hinsichtlich der Belastungswahrnehmung und der motorischen Funktionswiederherstellung nach ZNS-Schädigungen in Abhängigkeit vom Grad der Depressivität (Dissertation)
7) Psylex: Depressive haben eine genauere Wahrnehmung der Zeit (Studie 2013)
8) Sam Woolfe: Über Antinatalismus und Depression
9) Chin Meyer: Was ist depressiver Realismus? - 2021: Chin Meyer über depressiven Realismus und Staatsschulden
10) Joseph P. Forgas et al: The influence of mood on perceptions of social interactions (Studie)
11) Paul w. Andrews and J. A. Thompson: The bright side of being blue: Depression as an adaptation for analyzing complex problems (Studie 2009)
12) Rachel Adelson: Probing the puzzling workings of 'depressive realism'
13) Ben Y. Hayden: Depressive Realism May Not Be Real – Being depressed doesn't mean you see the world more clearly.
14) Thomas Beck et al: Depressive sehen besser — der Einfluss der Stimmung auf das Erkennen emotionaler Gesichter (Studie 2013)
15) Psylex: Verringerte visuelle Kontrastunterdrückung während schwerer depressiver Episoden (Studie 2021)
16) Christian Hilscher: Depression in der Pupille sehen (Max-Planck-Institut für Psychiatrie 2020)
17) Psylex: Hippocampus und Amygdala: Volumen der Gehirnbereiche verändern sich, wenn man ängstlich und depressiv ist (Studie 2020)
18) P. Videbech et al: Hippocampal volume and depression (Studie 2004)
19) Psylex: Neurowissenschaftler beobachten gestörte Integrität der Blut-Hirn-Schranke (Studie 2019)
20) Maxime Tequet et al: Mood Homeostasis, Low Mood, and History of Depression in 2 Large Population Samples (Studie 2020)
21) Paracelsus Recovery: Evolutionäre Wurzeln der Depression: Hat die Depression einen Zweck?
22) Katja Rothe: Unendliche Arbeit, unendliche Müdigkeit und die Verletzlichkeit der Wünsche
23) Manfred Spitzer: Traurig aber weise? Kurt Schneider und der depressive Realismus. In: Nervenheilkunde 2023; 42(07/08): 414-417. DOI: 10.1055/a-2049-9952 (lesenwert!)