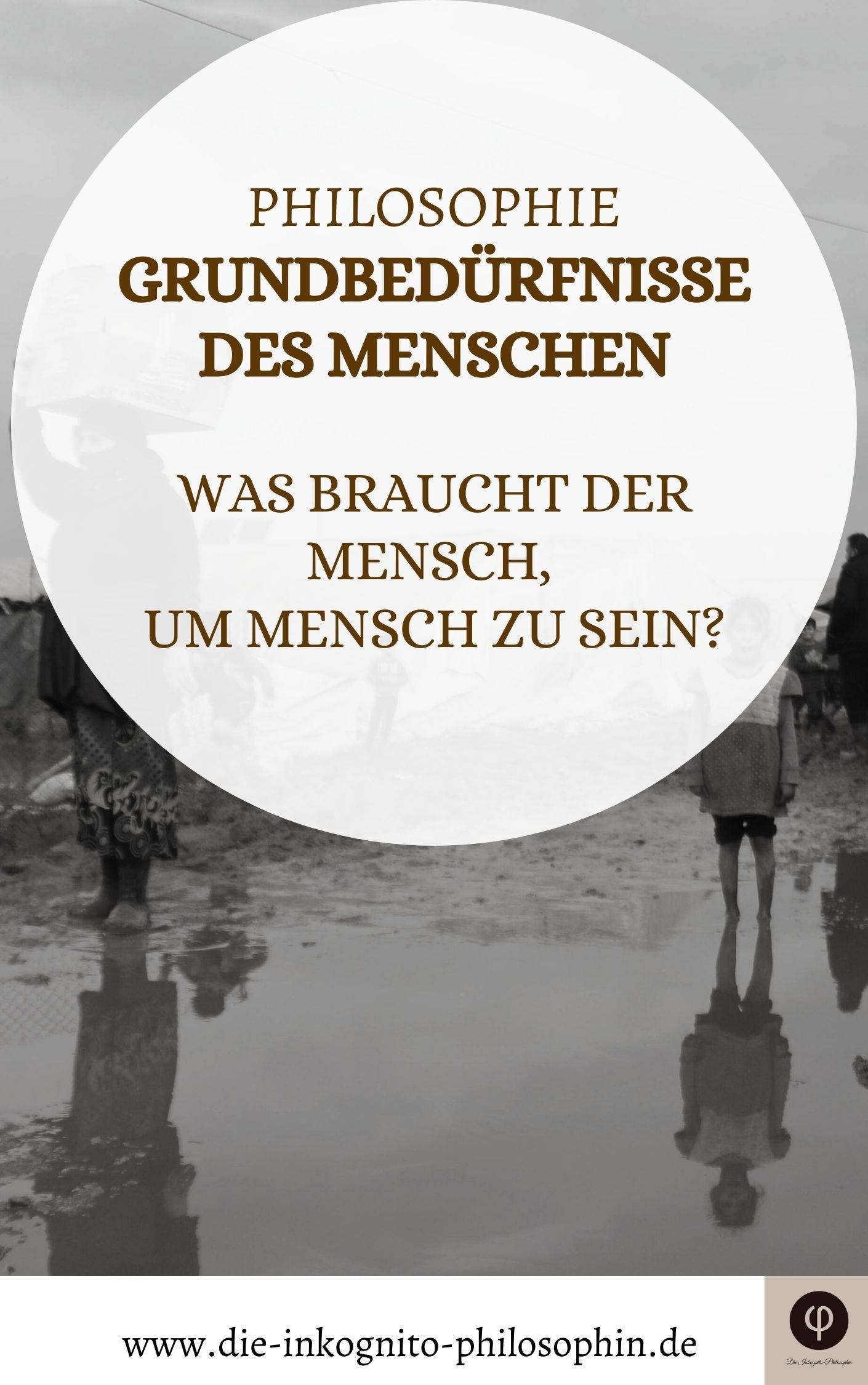Grundbedürfnisse des Menschen – Was braucht der Mensch?
Die Grundbedürfnisse des Menschen sind nicht nur fürs biologische Überleben notwendig, sondern auch für eine spezifisch menschliche Existenz. Doch was zu den menschlichen Grundbedürfnissen zählt, steht nicht fest, sondern ändert sich gemäß den Werten einer Gesellschaft oder Kultur. Was sind also echte Grundbedürfnisse des Menschen, die für alle Menschen gelten?
Physische und Psychische Grundbedürfnisse
Oft wird zwischen physischen Grundbedürfnissen (biologisches Überleben) und psychischen Grundbedürfnissen (Psychische Gesundheit, Glück) unterschieden. Aber macht diese Differenzierung wirklich Sinn?
Sind Grundbedürfnisse wandelbar?
Eine allgemeingültige Definition von Grundbedürfnissen existiert eigentlich gar nicht. Zum einen, weil in den verschiedenen Wissenschaften ein unterschiedliches Verständnis von den Grundbedürfnissen des Menschen vorherrscht.
Zum anderen, weil Grundbedürfnisse je nach Zeitepoche und Kultur sich immer wieder an Wertewandlungen anpassen.
Das Grundbedürfnis nach Nahrung und Flüssigkeit ist jedem Menschen gemein. Doch gerade seelisches oder geistiges Bestreben, das mit spezifischen Erwartungen und Vorstellungen einher geht, ist von Gesellschaft und Kultur bestimmt.
Interessant ist, dass Menschen in Krisen-Zeiten (Krieg, Hungersnöte, Umweltkatastrophen etc) ihre seelischen Bedürfnisse den Grundbedürfnissen ihrer physischen Existenz unterordnen sollen. Vielfach liest man auch, die geistigen Grundbedürfnisse würden sich in existenzieller Not sogar in Luft auflösen.
Das ist aber eine Fehldeutung, denn wenn es Grundbedürfnisse sind, verschwinden sie nicht einfach, sondern transformieren sich. So lässt sich in Folge von Krisen oft beobachten, dass die Nachfrage an spirituellen Angeboten zunimmt. Und auch glücklichen Zeiten ist die Vorstellung inhärent, dass bestimmte geistige Bedürfnisse erfüllt sein müssen.
Vgl. auch: Macht die Gesellschaft depressiv? Kritik der Kulturkritik
Was sind Grundbedürfnisse?
Ein Grundbedürfnis ist ein elementares Bedürfnis, das im Mindestmaß erfüllt sein muss, damit der Mensch leben kann oder menschenwürdig lebt.
Leider wird immer noch zwischen natürlichen Bedürfnissen als körperliche Basisversorgung (Schlaf, Nahrung, Schutz) und künstlichen Bedürfnissen als geistige Grundversorgung (Bildung, Arbeit) unterschieden.
Tatsächlich ist die Differenzierung aber umstritten.
Unterschied: Bedürfnisse und Wünsche
Aber was unterscheidet jetzt ein Bedürfnis von einem Wunsch? In konsumorientierten Gesellschaften, wie der unseren, werden die Begriffe „Bedürfnis“ und „Wunsch“ häufig synonym benutzt.
Allerdings sind Bedürfnisse an sich nach allgemeinen und psychologischem Verständnis so etwas wie biologische Mangelzustände, die das Individuum beheben will.
Bedürfnis ist etwas Notwendiges. Ein Bedürfnis muss erfüllt sein, damit ein Mensch keine anhaltenden, schwerwiegenden körperlichen, seelischen oder geistigen Schäden erleidet.
Wunsch ist etwas Nicht-notwendiges. Ein Wunsch ist ein Begehren, dessen Nichterfüllung zu keinen anhaltenden, schwerwiegenden körperlichen, seelischen oder geistigen Schäden beim Menschen führt.
Arten von Bedürfnissen
Individualbedürfnisse können von einem Menschen alleine befriedigt werden (z. B. das Bedürfnis zu essen).
Grundbedürfnisse (für ein möglichst nachhaltig gesundes Leben) umfassen Schlaf, Nahrung, Respekt, Selbstbestimmung, Unterkunft, Gemeinschaft, Gesundheit, Bewegung und Heilung bei Krankheit etc.
Luxusbedürfnisse umfassen die Bedürfnisse nach luxuriösen Gütern (Schmuck, Auto usw.) und Dienstleistungen, auch wenn sie an anderen Stellen Not, Leid und Umweltfrevel fördern.
Kollektivbedürfnisse können nur von einer ganzen Gemeinschaft (z. B. Familie) befriedigt werden (z. B. das Bedürfnis nach Sicherheit).
Existenzbedürfnisse sind solche, die auch bei Mangel, in der Not noch realisierbar erscheinen oder selbst bei Strafe noch gewährt werden. Zum Beispiel ausreichende Nahrung und Wasser, Luft, Kleidung, Wohnraum.
Kulturbedürfnisse beschreiben den Wunsch nach Kultur (Ästhetik, kreativem Ausdruck, Feiern, Herstellen innerer Konsistenz, Bildung)
Bedürfnispyramide nach Maslow
Wer sich etwas mit dem Begriff beschäftigt, trifft unweigerlich auf die maslowsche Pyramide. Sie ist federführend für die meisten Darstellungen von Grundbedürfnissen, insbesondere den Wirtschaftswissenschaften. Und das, obwohl Maslow selbst eigentlich überhaupt nicht erklärt, was die Grundbedürfnisse (als unterste Stufen in der Bedürfnishierarchie) von anderen Bedürfnissen abgrenzt.
Bedürfnispyramide nach A. Maslow ©Wikipedia
Abraham Maslow war Verhaltensforscher, der in den 1940er Jahren seine Bedürfnispyramide entwickelte, die vor allem in der Arbeitswelt gerne herangezogen wird. Nach Maslow lassen sich die Bedürfnisse des Menschen in 5 Ebenen unterteilen:
Auf der 1. bis 3. Ebene von unten gezählt, befinden sich die sogenannten Defizitbedürfnisse. Ein Defizitbedürfnis ist ein physiologisches Bedürfnis, das Defizite wettmachen soll. Dazu zählen Hunger oder Durst stillen oder Ruhe und Schlaf, aber auch Sicherheit und Zuneigung.
Davon abzugrenzen sind die Wachstumsbedürfnisse bzw. Individualbedürfnisse nach Anerkennung und Selbstverwirklichung, die auf den obersten Ebenen angesiedelt sind.
Maslow dachte sich sein Konzept aber nicht als Hierarchie in Form einer Pyramide: „Bisher hat unsere theoretische Diskussion möglicherweise den Eindruck erweckt, dass diese fünf Sätze von Bedürfnissen irgendwie in einer sukzessiven Alle-oder-keine-Beziehung zueinander stehen. Wir haben es so formuliert: „Wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, so entsteht ein anderes.“ Diese Aussage könnte den falschen Eindruck schaffen, dass ein Bedürfnis zu 100 Prozent erfüllt sein muss, bevor das nächste entsteht.“ (zitiert nach Wikipedia)
Vielmehr ist Maslows Idee so zu verstehen, dass sich physiologische Bedürfnisse immer dann äußern, wenn sie gebraucht werden. Psychische Bedürfnisse, die zu den Individual- und Wachstumsbedürfnissen zählen, sind hingegen ständig da. Es geht also um Bedürfnis-Dimensionen oder -Strukturen, die sich gegenseitig überschneiden.
©Wikipedia
Hintergründe zu Maslows Bedürfniskonzept
Maslow stellte mit seinem Schema einen Gegenentwurf zum mechanistischen Menschenbild nach Freud auf. Er wollte nicht animalisches und pathologisches Verhalten als Maßstab für menschliche Bedürfnisse gebrauchen und gilt als Mitbegründer der Humanistischen Psychologie.
Maslow stellt das Erleben der Person ins Zentrum seiner Überlegungen um die Grundbedürfnisse des Menschen. Sinnhaftigkeit ist der entscheidende Aspekt (Kreativität, Selbstverwirklichung, Wahlfähigkeit etc.) sowie der Werte- und Würdeerhalt.
Vgl. Was ist der Sinn des Lebens heute?
Vgl. auch: Was ist Philosophie?
Psychische Grundbedürfnisse
Was braucht der Mensch für seine psychische Gesundheit?
Auch in der Psychologie sind die Grundbedürfnisse des Menschen immer mal wieder in Diskussion. Jedenfalls sollen auch die psychischen Grundbedürfnisse universell sein, ebenso wie Basisemotionen.
Die wichtigsten 4 Säulen für psychische Gesundheit sollen sein:
Sicherheit
Veränderung (Wechsel)
Freiheit
Verbundenheit.
Je nach Autor und psychologischer Richtung ist aber auch von Bindungsbedürfnis, Orientierung und Kontrolle, Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz oder Lustgewinn und Unlustvermeidung die Rede.
Weiter Beispiele für psychische Grundbedürfnisse sind dann noch Sicherheit, Gruppenzugehörigkeit, Veränderung, soziales Geltungsbedürfnis, Freiheit, Autonomie, Kreativität, menschliche Begegnungen und Konsistenz.
Bedürfnisse in der gewaltfreien Kommunikation
Interessant ist in diesem Zusammenhang das Modell der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg, das auch gerne aufgegriffen wird:
demnach sind Bedürfnisse allgemein: sie sind unabhängig von Zeiten (Epochen), Orten (Regionen, Kulturen) und Personen.
sie stehen einander nie entgegen, sondern lediglich die Strategien, die zur Erfüllung der Bedürfnisse angewandt werden.
der Mensch hat in jedem Moment Bedürfnisse
Kernbegriffe nach diesem Modell: physische Bedürfnisse – Sicherheit – Verständnis (oder Empathie) – Kreativität – Liebe Intimität – Spiel – Erholung – Autonomie – Sinn.
Grundbedürfnisse in der Philosophie
Wie wichtig Grundbedürfnisse für den Menschen sind, zeigt sich an zahlreichen Einzeldebatten (Hartz IV, Kinderarmut, Rente). Oft werden die Diskussionen aber ohne die Disziplin geführt, die sich am längsten und tiefsten mit der conditio humana auseinandergesetzt hat: der Philosophie.
Der moderne Philosoph Martin Seel meint, dass „zu einem erträglichen menschlichen Zustand neben der Erfüllung auch das Verlangen nach Erfüllung gehört“ (1) – damit ist die Motivation und der Antrieb gemeint, überhaupt etwas mit Leidenschaft zu tun. Und da ist Seel deutlich näher an der heutigen Lebenswelt als viele andere.
In vielen heutigen Texten der Philosophie wird auf die antiken Glückseeligkeitskonzepte zurückgegriffen. (Vgl. Was ist Glück?)
Im alten Griechenland, der Geburtsstätte der abendländischen Philosophie, galt die Befriedigung von Bedürfnissen als Glücksquelle. Allerdings wurde zwischen niedrigen „Gelüsten“ und hehren Bedürfnissen unterschieden.
Zu den wertvollen Bedürfnissen bzw. Freuden gehörten demnach Denken (Philosophieren), Musizieren etc.
So sagte Epikur: „Willst du jemanden reich machen, musst du ihm nicht das Gut mehren, sondern seine Bedürfnisse mindern.“
Epikur & die Bedürfnisse (Lust & Unlust)
Der Vorsokratiker Epikur muss überhaupt sehr oft herhalten, wenn heute über Bedürfnisse diskutiert wird. Leider wird die philosophische Schule des Epikur heute noch immer zu Unrecht mit einem extremen Hedonismus, einer ausschweifenden Zügellosigkeit und Sinnesberauschung, gleichgesetzt.
Dabei wird Epikur irrtümlicherweise unterstellt, er verstehe unter Lust eine unbegrenzte Befriedigung aller Begierden. Ursprünglich ist der epikureische Lustbegriff aber viel durchdachter: Lust definiert sich als Abwesenheit aller Art von Schmerzen (vgl. 3. Hauptlehrsatz des Epikur).
Als notwendig zu befriedigende Bedürfnisse sind demnach lediglich solche zu betrachten, die ein Leben ohne schmerzliche Entbehrung – z.B. durch Hunger, Durst oder Kälte – naturgemäß verlangt.
Epikur erachtet die notwendigen Bedürfnisse (Grundbedürfnisse) als wichtiger als die nicht-notwendigen. Er unterteilt außerdem die nicht notwendigen Bedürfnisse zusätzlich in naturbedingte und nicht naturbedingte (vgl. 29. Hauptlehrsatz).
Zudem betont der Epikureismus: ein gutes Leben sei nur unter Anerkennung der natürlichen Grenzen möglich und eine maßlose Bedürfnisbefriedigung unnötig und schädlich.
Epikurs Lustbegriff ist daher eigentlich ein Genügsamkeitsbegriff. Seine Vorstellungen für ein gelungenes gutes Leben decken sich zu großen Teilen mit denen moderner Theoretiker, die davon ausgehen, dass ab einem gewissen Wohlstand mehr Konsum nicht mehr zu wachsender Befriedigung führt.
Epikur gab in diesem Kontext an:
„Das leibliche Behagen nimmt nicht mehr zu, sobald der Schmerz des Entbehrens ausgetilgt ist, es verfeinert sich nur.“
(18. Hauptlehrsatz des Epikur)
Wenn Epikur von Wohlergehen spricht, dann meint er eine geistige Ebene, keine bloß körperliche. Oder wie die Phänomenologen sagen würden: er spricht von der leiblichen Existenz des Menschen, die möglichst angstfrei und sicher sein möchte. Epikur ging es also um eine maßvolle Befriedigung der Grundbedürfnisse, sowohl körperlicher als auch geistiger Art, nicht um eine Befriedigung aller möglichen Bedürfnisse.
Bedürfnis-Skepsis in der modernen Philosophie
Weder in der antiken noch in der modernen Philosophie findet sich eine einheitliche Bedeutung des Begriffes. Je nach Zeitepoche und Strömung, zeigen sich unterschiedliche Menschenbilder mit unterschiedlichen Einzelbedürfnissen. Vgl. auch Dialektische Menschenbilder: Marx – Fromm – C. G. Jung – Schmitz – Mehrgardt
So gehen Anhänger Freuds von triebhaften Bedürfnissen aus (Hunger, Durst, Sex), welche das liefern, was der Mensch braucht. Wer es hingegen mit Hobbes hält, der entdeckt in den Grundbedürfnissen einen Ausdruck von Selbsterhaltungs- und Machtansprüchen.
Im ethischen Zusammenhang (z.B. Utilitarismus) sind Bedürfnisse ebenfalls relevant (Mill) und werden ähnlich dem Epikureismus in höhere (geistige Interessen) und niedere (sinnliche Lust) Bedürfnisse unterteilt.
Schopenhauer schrieb wiederum: „Dass das menschliche Dasein eine Art Verirrung sein müsse, geht zur Genüge aus der einfachen Bemerkung hervor, dass der Mensch ein Konkrement von Bedürfnissen ist, deren schwer zu erlangende Befriedigung ihm doch nichts gewährt als einen schmerzlosen Zustand, in welchem er nur noch der Langeweile preisgegeben ist.“
Hegel führt dann zum ersten mal sozialphilosohische Argumente ins Feld, wenn er darauf hinweist, dass Menschen die Natur zuerst bearbeiten müsste, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Die bürgerliche Gesellschaft ist für ihn ein System gegenseitiger Abhängigkeiten, also ein System von Bedürfniserweckung und Bedürfnisbefriedigung.
Diesen gesellschaftskritischen Gedanken hat auch Marx aufgegriffen: „Die Theorie wird in einem Volke immer nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist. [...] Werden die theoretischen Bedürfnisse unmittelbar praktische Bedürfnisse sein?
Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen.“ (Marx)
Der Mensch erscheint dem Menschen stets nur als Mittel zum Zweck der persönlichen Bedürfnisbefriedigung. Noch schlimmer: Die gegenseitige Verzwecklichung entfremdet die Menschen voneinander.
Zudem übt Marx starke Kritik an der Naturentfremdung. Da der Mensch seine Güter selbst herstellt, produziert er auch neue Bedürfnisse – quasi eine 2. Natur. Doch diese Bedürfnisse sind gesellschaftlich und kulturell genormt. Marx hielt daher die Existenz von rein biologischen Bedürfnissen für verfehlt und fehl leitend.
Philosophische Anthropologen (Gehlen, Fromm) stellen den biologischen Bedürfnissen noch menschliche Bedürfnisse zur Seite: Interesse für Handlungsfreiheit, Verbundenheit oder emotionale Ausgerichtetheit.
Vom Wesen der menschlichen Bedürfnisse
In der Kritischen Psychologie betont man, dass Lebewesen einen Bedarf haben, aber nur Menschen Bedürfnisse. Doch ein Bedürfnis zeigt nicht immer an, wonach ich verlange (wie komischerweise viele glauben).
Wichtig ist hier, sich zu vergegenwärtigen, dass dasjenige, was mein Bedürfnis befriedigt, nicht das Bedürfnis an sich ist, sondern mein persönlicher Ausdruck und mein individuelles Verlangen, die aus mir selbst herauskommen.
Ein Bedürfnis ist also kein Objekt oder Gegenstand – also nichts äußerliches. Ein Bedürfnis ist aber auch kein bloßer Seelenzustand, der nur auf mich selbst Auswirkungen hat – also nichts innerliches. Stattdessen ist das Bedürfnis eine Art Verhältnis zwischen Innen und Außen, das vom Einzelnen mit Emotionen besetzt wird.
Etymologie und Sinn des Bedürfnisses
Das Wort Bedürfnis ist zusammengesetzt aus:
Be- einer Vorsilbe, die unbetonte Form der Präposition bei. Diese geht wiederum auf Indogermanisch “um…herum” (=ambhi) zurück. Bedeutet im Deutschen dann: nahe bei. Interessant ist, dass diese Vorsilbe auch eine räumliche Nähe ausdrückt.
der zweite Wortteil stammt vom Verb dürfen, was so viel bedeutet wie: ein Recht haben, Ursache haben, brauchen, nötig haben. Die Sprachwissenschaft vermutet, der Begriff könnte mit dem Altgriechischen "terpein” = sättigen, genießen - dem Russischen trebovat = fordern – der Indoeuropäischen Wurzel terp/trep in Verbindung stehen, was im Grunde “sich sättigen, genießen” bedeuten würde.
Ein Bedürfnis ist ein Anrecht auf Erfüllung, das dem Menschen damit beigelegt ist. Es gehört zum Wesen des Menschen.
Bedürfnisse kommen also nicht einfach so von außen. Essen und Trinken sind deshalb elementare Bedürfnisse, weil sie zu seinem Wesen dazugehören.
Bedürfnisse brauchen keinen Mangel, um ein Bedürfnis zu sein
Die psychologische Definition, ein Grundbedürfnis entstehe aufgrund eines Mangels und solle diesen beheben, erscheint mir nicht plausibel. Vielversprechender ist stattdessen der Gedanke, dass Grundbedürfnisse auf Potenziale hinweisen.
Nicht, weil ein negativer Begriff ins Positive gewendet werden soll, sondern weil Bedürfnisse handlungsorientiert sind, ebenso wie Gefühle und Gedanken. Wir geben uns nicht passiv irgendwelchen Bedürfnissen hin, sondern wir werden von ihnen zur Aktion motiviert. Das ist eine Bewegung, kein Stillstand.
Bedürfnisse hängen auch mehr damit zusammen, was der Einzelne für seine Zufriedenheit als nötig erachtet. Zufriedenheit hängt von Erwartungen, Selbstbild und Selbstansprüchen ab – was nicht heißt, sie wären nur subjektive Gebilde.
Doch das erklärt, warum ein Mensch sich über eine Schüssel Suppe freuen kann, während ein trotz aberwitzigem Reichtum nicht glücklich wird.
Bedürfnisse sind nicht isoliert, sondern stehen im Wechselverhältnis
Ebenso bringt die Differenzierung von Grundbedürfnissen, Existenzbedürfnissen, Individualbedürfnissen und Kollektivbedürfnissen mehr Verwirrung als Erhellung. Sind einzelne Bedürfnisse nicht auch wechselseitig bedingt?
Kann ich Kollektivbedürfnisse einfach so von meinen Individualbedürfnissen trennen, obwohl ich die Gemeinschaft doch zur Ausbildung und Aufrechterhaltung von Identität und Selbstbestimmung brauche?
Einige Philosophen sprechen in diesem Zusammenhang von Spannungsverhältnissen, die den Menschen zur Wahl bzw. Aktion zwischen verschiedenen Möglichkeiten antreiben.
Das Tranzszendentale Grundbedürfnis des Menschen
Viele Arten von Bedürfnissen, die heute den physiologischen und psychologsichen Grundbedürfnissen zugeordnet werden, können zwar befriedigt sein, doch das heißt nicht, dass sie auch Erfüllung bieten. Scheinbar reichen Gruppenzugehörigkeit und Formen der Selbstbestimmung nicht aus, damit sich Menschen glücklich fühlen.
Die Philosophie bringt daher ein anderes, umfassenderes Grundbedürfnis ins Spiel: das Bedürfnis, über die Grenzen der eigenen Person hinauszugehen. Dabei geht es nicht ums Ego, sondern das Hinausgehen über Ich-Grenzen. Andere sprechen in diesem Zusammenhang von einem transzendenten Trieb (Ludger Tebartz van Elst).
Das können wir: Einerseits, indem wir lebensweltlich auf andere Menschen und die Umwelt ausgerichtet sind (zeitlich, räumlich, emotional, kognitiv, kollektiv etc.). Andererseits indem wir Teil einer gemeinsamen Lebenswelt sind, deren Strukturen auf uns einwirken und die wir wiederum durch unser Handeln beeinflussen.
Ich persönlich glaube, ähnliches meinen die Buzzwords Urvertrauen, Kohärenzsinn, Sinnbedürfnis, das große Ganze u.s.w. Der Menschen braucht das Gefühl, mit Mitmenschen und Umwelt im Einklang zu sein - zumindest in einem gewissen Maße.
Einklang schließt übrigens ein Hierarchie-Verhältnis aus. Wer Sinn verwirklicht, unterwirft sich nicht in den Dienst an einer Sache (Dualismus), sondern verschmilzt damit, geht darin auf (6).
Ich spreche hier von einem existenziellen Bedürfnis nach Erfüllung durch Einklang, wie wir es zum Beispiel von Religionen, spirituellen Bewegungen, Ideologien oder Philosophien kennen.
Evtl. interessant für Dich: Was dich nicht umbringt, macht stärker – Wachstum nach Trauma?
„Die Lehre der Stoiker, dass wir unseren Bedürfnissen durch Ausrottung unserer Begierden abhelfen sollen, kommt mir ebenso vor, als wenn wir uns die Füße abschneiden sollten, damit wir keine Schuhe brauchen.“
- Jonathan Swift
Fazit: Grundbedürfnisse des Menschen
Sind Grundbedürfnisse jetzt eine persönliche Sache oder sozial und kulturell konstruiert? ich denke beides, sowohl als auch. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Als zusammenhaltender Bogen, der soziale, individuelle und anthropologische Grundbedürfnisse überspannt und einrahmt, könnte das Transzendentale Bedürfnis des Menschen gelten.
Wie auch immer…Du siehst, die Sache mit den Grundbedürfnissen des Menschen ist nicht so einfach zu beantworten und wird noch viele Debatten aufwerfen.
Ich kann sie an dieser Stelle nicht beantworten, auch wenn viele gerne auf Maslow verweisen, der eine schöne Inspirationsquelle lieferte, aber kein überprüfbares Konzept:
Der gute alte Abe hat sich nämlich rein auf seinen Erfahrungsschatz verlassen und weder Studien noch sonstige Daten herangezogen. Nach heutigen wissenschaftlichen Maßstäben entbehrt die maslowsche Pyramide daher jeder Evidenz, welche heute so gern als “objektiver Maßstab” gefordert wird.
Quellen
1) Philosophie der Lebenskunst: Seels Paradoxie des Glücks (Zeitschrift: Information Philosophie)
2) Metzler Lexikon der Philosophie
3) Thomas von Aquin: Summa theologiae I-II
4) Epikur: Wege zum Glück
5) Epikur: Briefe, Sprüche, Werkfragemente
6) Michael Depner: Bedürfnisse
7) Wolfgang Pfeifer et al: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993)
8) Stephan Schleim: Transzendenter Trieb – der Wunsch uns zu übersteigen