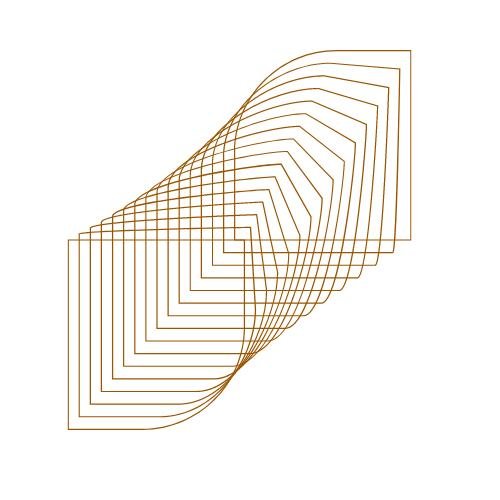Vulnerabilitäts-Stress-Modell – Erklärung & Kritik / Mängel
Mit dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell (auch Diathese-Stress-Modell) wird die individuelle Anfälligkeit für psychische Erkrankungen erklärt. Der Ansatz ist äußerst beliebt. Allerdings hat das Diathese-Stress-Modell einige theoretische Mängel aufzuweisen, die kaum bekannt sind.
Das Diathese-Stress-Modell
Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell ist eines der bekanntesten Konzepte in der klinischen Psychologie, das erklären soll, wie psychische Erkrankungen entstehen können.
Inhaltsverzeichnis: Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Definition: Vulnerabilität + Stress
Das Fass-Beispiel – Das Modell einfach erklärt
Zentrale Elemente:
Wissenschaftstheorie: Kritik am Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Konzept des Individuums
Konzept der Krankheit
Vereinfachung auf Ursache und Wirkung
Nivellierung von Erfahrungsqualitäten
Marginalisierung sozialer Faktoren
Fazit: Reduktionismus
Das vulnerable Individuum
Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell ist sehr bekannt und verbreitet, um die Entstehung seelischer Krankheiten verständlich zu machen. Wie unschwer zu erkennen ist, spielen hier 2 Voraussetzungen eine Rolle: Stress und “Verletzlichkeit”.
Mit der Vulnerabilität eines Menschen ist die Anfälligkeit für psychische Krankheit gemeint. Es geht um eine Tendenz zur schnelleren Verletzbarkeit aufgrund genetischer Dispositionen, biografischer oder sozialer Einflüsse und ungünstiger Charaktereigenschaften.
Kommt es zu einer Belastungssituation (Stress, Krise), dann erkranken vulnerable Menschen psychisch. Soweit die einfache Erklärung.
Der entscheidende Punkt bei diesem Ansatz sind nicht die biologischen, genetischen, biografischen Faktoren und Stress. Sie sind keine hinreichenden Bedingungen für die Krankheitsentstehung. Vielmehr ist die individuelle Vulnerabilität der ausschlaggebende Faktor in dieser Deutung.
Synonym: Diathese-Stress-Modell
Der Begriff "Diathese" stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "Anlage" oder "Veranlagung". Er bezieht sich auf genetische, biochemische oder psychosoziale Faktoren, die eine Person anfälliger für psychische Erkrankungen machen könnten. Diese Anfälligkeit sollte nicht deterministisch verstanden werden; sie beschreibt lediglich eine Tendenz, die unter bestimmten Bedingungen sichtbar werden kann.
Definition: Vulnerabilität + Stress
Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell hieß ursprünglich “nur” Vulnerabilitätsmodell und wurde von Zubin & Spring (1977) zur Erläuterung der Schizophrenie eingeführt.
Von da an machte es Karriere: aufgrund seiner Allgemeinheit wird dieses Ursache-Wirkungs-Prinzip auch auf andere psychische Krankheiten oder psychische Problematiken übertragen.
(1) Vulnerabilität = negative individuelle, biologische, genetische, biografische, soziale und persönliche Dispositionen
(2) Stress = kritische Belastungen vielfältiger Art
(3) psych. Aspekte (z. B. Resilienz, Coping, soziales Netz) & entwicklungsbezogene Faktoren (z. B. Bindung, Emotionsregulation) modifizieren die Krankheit und ihre Symptome
Das Fass-Beispiel
Vulnerabilitäts-Stress-Modell einfach erklärt
Um den Ansatz und die Verbindung zwischen Verletzbarkeit und Stress zu verdeutlichen, wird oft das Fass-Beispiel gewählt. Damit vulnerable Personen besser zurechtkommen, sollen sie sich nach der Empfehlung vieler “Experten” mit Selbsthilfe und Psychotherapie einen “Überlaufschutz” aneignen.
Fass 1
kaum Risikofaktoren
geringe Vulnerabilität
Ergebnis:
kommt Stress hinzu, besitzt das Fass immer noch genug Platz
Fass 2
ein paar Risikofaktoren
Vulnerabilität erhöht
Ergebnis:
Weniger Platz, aber Stresspegel liegt noch unterhalb des Randes
Fass 3
viele Risikofaktoren
Vulnerabilität stark erhöht
Ergebnis:
Fass im Normalzustand schon fast voll. Stress bringt es zum Überlaufen.
Zentrale Elemente – Wie entsteht Vulnerabilität?
Vulnerabilität wird angeboren oder erlernt, heißt es in der Psychologie. Das Ausmaß der Verletzlichkeit wird dann wiederum durch Schutzfaktoren abgemildert oder durch Risikofaktoren verstärkt.
Kindbezogene Risikofaktoren:
Frühgeburt, Geburtskomplikationen
genetische Faktoren
chronische Erkrankungen
schwierige Persönlichkeitsmerkmale
unsichere Bindung
schwache Kognition
fehlende Emotionsregulation
neuropsychologische Schäden
Umweltbezogene Risikofaktoren:
dysfunktionale Erziehung
Aufwachsen bei Alleinerziehenden
niedriger sozioökonomischer Status
psychisch kranke Eltern
geringes Bildungsniveau der Bezugspersonen
häufige Umzüge oder häufiger Schulwechsel
traumatische Erfahrungen
Schutzfaktoren sollen den Grad der Vulnerabilität positiv beeinflussen und stehen in Wechselwirkung miteinander.
Schutzfaktoren
Kind:
Kognitive Fähigkeiten
Positives Temperament
Positive Selbstwahrnehmung
Selbstwirksamkeits-erwartung
Soziale Kompetenzen
Aktive Bewältigungs-strategien
Kreativität & Fantasie
Schutzfaktoren Familien:
Emotional warmes und klar strukturiertes Erziehungsverhalten
Stabile Bindung zu mindestens einer Bezugsperson
Positive Beziehung zu vorhandenen Geschwistern
Positive Merkmale der Eltern
Schutzfaktoren Umwelt:
Soziale Unterstützung
Qualität der Bildungsinstitutionen
Soziale Modelle
Wissenschaftstheorie:
Kritik am Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Aus den Reihen der Psychologie wird die Einseitigkeit des Vulnerabilitäts-Stress-Modells kritisiert: Es ist sehr pejorativ geprägt.
Gerade die positive Psychologie oder die Resilienzforschung pochen daher auf die positiven Aspekte von vulnerablen Personen, die nicht nur negativ ausgelegt werden können (vgl. Quellen 3 und 4).
-
“Allerdings sind derartige Modelle noch weit von einer umfassenden wissenschaftlichen Begründung entfernt. Weder die entscheidenden Subprozesse noch die übergeordneten Zusammenhänge sind für einzelne psychische Störungen oder Gruppen von Störungen hinreichend spezifiziert und wissenschaftlich abgesichert.
Nichtsdestotrotz besitzen sie einen erheblichen Wert in Bezug auf die weiterführende Grundlagen- und Anwendungsforschung. Darüber hinaus sind sie auch heuristisch hilfreich für die therapeutische Praxis im Zusammenhang mit der Diagnostik und der Steuerung des Einsatzes von Interventionen.
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisbasis über psychische Störungen insgesamt noch außerordentlich schmal ist. Bis heute haben wir für keine einzige psychische Störung hinreichend gesicherte ätiologische und pathogenetische Modelle, die es erlauben, alle relevanten Befunde widerspruchsfrei einzuordnen und entsprechende wissenschaftlich begründete Interventionen abzuleiten.
Selbst relativ einfach erscheinende Fragen nach den wichtigsten Risikofaktoren und Vulnerabilitäten können zumeist nicht mit hinreichender Präzision beantwortet werden.
Die Suche nach adäquateren Modellen und die bessere Aufklärung von spezifischen Schlüsselprozessen für die Entstehung und den Verlauf gestörter Funktionen und gestörter Funktionsmuster im Sinne psychischer Störungen ist und bleibt damit eine Schlüsselaufgabe der Klinischen Psychologie.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisdefizite sind in allen Bereichen – den Grundlagen und der Anwendung markant und unterstreichen, dass eine kontinuierliche und systematische interdisziplinäre Forschungsorientierung eine Grundforderung des Fachs Klinische Psychologie ist.
Diese Situation ist kein Spezifikum der Klinischen Psychologie, sondern gilt gleichermaßen für alle Fächer, die sich mit psychischen Störungen und klinischen Fragestellungen befassen.
Für die Klinische Psychologie haben also bis heute alle diskutierten Perspektiven einen mehr oder minder groben Wert im Hinblick auf das Verständnis und die Erklärung, z. B. hinsichtlich der Frage, warum psychische Störungen auftreten, aber auch in Hinblick auf die Wirkmechanismen.
Hans-Ulrich Wittchen: Klinische Psychologie & Psychotherapie. Springer, 2011, Kap. 2, S. 21–23 (bei Google Books)”
Konzept des Individuums
Der Einzelne ist Subjekt, dessen psychische “Qualität” die Schlüsselrolle in der Krankheitsentstehung spielt. Das Subjekt strebt danach, Störungen zu überwinden und agiert daher aus Gründen.
So weit, so gut. Die Menge an Reizen und Einflüssen (Stressoren) sind also nicht relevant – aber: Warum erfahren sie dann im Modell eine quantitative Darstellung? Und inwiefern lässt sich die psychische Qualität eines Menschen bemessen? (vgl. 6)
Konzept der Krankheit
Auch das Vulnerabilitätskonzept versteht Krankheit als ein Sein, das sich eindeutig von Gesundheit unterscheiden lässt. Dabei wird apriorisch eine “Erkrankungsschwelle” gesetzt.
Es kommt aber noch dicker: Subjektivität wird grob in Vulnerabilität, Stressoren und Coping aufgespalten, die sich gegeneinander (quantitativ) aufrechnen lassen sollen.
Vereinfachung auf Ursache und Wirkung
Wenn wir uns das Vulnerabilitäts-Stress-Modell genauer ansehen, dann wird letztlich ein naiver Ursache-Wirkungs-Zusammenhang von Reiz (Stress), Individuum (Vulnerabilität) und Reaktion (psychische Krankheit) konstruiert, in dem das sinnvolle und begründete Handeln Betroffener überhaupt keinen Platz findet.
Nivellierung von Erfahrungsqualitäten
Unter das Konzept “Stressor” fällt jede Art von Belastung. Dabei wird allerdings übersehen, dass Erfahrungen sich nicht einfach miteinander gleichsetzen lassen. Erfahrungen unterscheiden sich in ihrer Bedeutung und ihren Wirkungen für das jeweilige Subjekt in einer bestimmten Situation.
Erlebnisse, egal ob positiver oder negativer Art, rein quantitativ zu definieren, bedeutet ein wesentliches Merkmal von menschlichen Erfahrungen zu übergehen: nämlich die individuelle Erlebnisqualität.
Marginalisierung sozialer Faktoren
Der Fokus liegt auf der mangelhaften Bewältigungsfähigkeit des Einzelnen. Und die soll dann mit therapeutischer Hilfe verbessert werden.
Aber was ist mit den sozialen, gesellschaftlichen und politischen Einflussfaktoren bzw. Einschränkungen, die zur Erkrankung führten, beitragen, sie aufrechterhalten etc? Sie werden vereinfacht in den Topf der Stressoren geworfen.
Und schon gar nicht in Frage gestellt, sondern auf die individuelle Ebene verschoben.
Im Klartext: Gesellschaftliche Missstände und soziale Faktoren werden nicht berücksichtigt. Es geht nur darum, dass sich das Individuum wieder in die Gegebenheiten einfügt, ohne das Gefühl zu haben, zu leiden.
Klassismus in der Therapie – die soziale Frage sowie Armut & Depression (Gesundheitliche Ungleichheit)
Fazit: Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Wer denkt, Komplexität ließe sich derart reduzieren, der findet im Vulnerabilitäts-Stress-Modell eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche Auswirkung von Belastungen auf den Menschen.
Aus philosophischer Perspektive ist das ganze Konzept sowie seine Weiterentwicklungen zu reduktionistisch und blendet die subjektive Seite aus. Insbesondere die Qualität von Erfahrungen wird hier überhaupt nicht berücksichtigt.
Den Menschen, sein Fühlen, Denken und Verhalten allein über einfache Ursache-Wirkungs-Mechanismen zu erklären, wird niemandem gerecht. Und lässt viele Fragen offen.
Noch viel schlimmer: Werden kritische Lebensumstände ausgeblendet, kann jede Therapie von psychischen Problemen nur eine kurzfristige Lösung darstellen, die keinen echten Mehrwert für Patienten bietet.
Das könnte Dich auch interessieren:
Pathologisierung & Medikalisierung – Die kranke Gesellschaft?
Medikalisierung – Beispiel: Depression & Antidepressiva
Persönlichkeitsmodelle » Menschenbilder: Freud, Rogers, Perls (Teil 1)
Dialektische Menschenbilder: (Teil 2) Marx – Fromm – C. G. Jung – Schmitz – Mehrgardt
Mythos: Was Dich nicht umbringt, macht Dich stärker – Wachstum nach Trauma?
Vom Symptom zur Diagnose – Checkliste Depression
Quellen:
1) Hans-Ulrich Wittchen: Klinische Psychologie & Psychotherapie. Springer, 2011 (PDF online)
2) Dorsch Lexikon der Psychologie, Hofgrefe online
3) M. Pluess und J. Belsky: Vantage sensitivity: Individual differences in response to positive experiences. In: Psychological Bulletin, Vol 139(4), Jul 2013, 901-916
4) B. de Villiers, F. Lionetti und M. Pluess: Vantage sensitivity: a framework for individual differences in response to psychological intervention. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 53, 545–554 (2018), https://doi.org/10.1007/s00127-017-1471-0
5) G. Ernst, A. Franke und P. Franzkowiak: Stress und Stressbewältigung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, doi:10.17623/BZGA:Q4-i118-2.0
6) Simon Groten: Abstrakt isoliert ist nicht kapiert – zur Kritik am Konzept der ›psychischen Krankheit‹. In: Forum kritische Psychologie Spezial, 2018