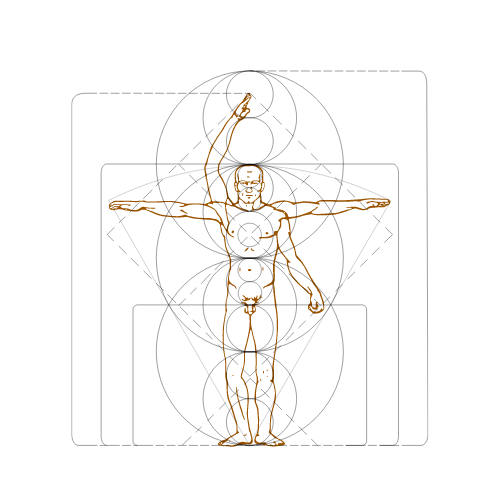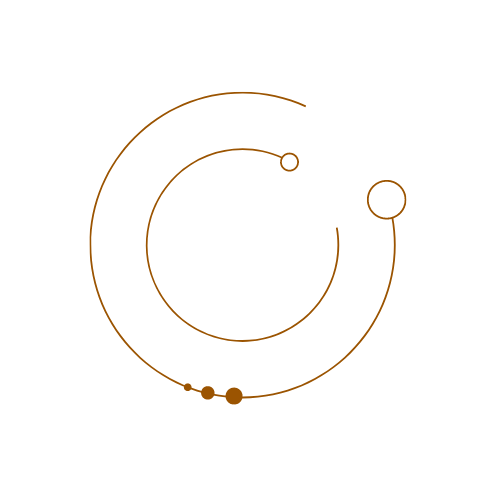Dialektische Menschenbilder: Marx – Fromm – C. G. Jung – Schmitz – Mehrgardt
Viele Persönlichkeitstheorien vertreten rein formal einen dialektischen Ansatz, erfüllen aber nicht die philosophischen Kriterien von dem, was Dialektik eigentlich bedeutet. In diesem Beitrag auf dem Prüfstand: die Menschenbilder von Karl Marx, Erich Fromm, Keupp & Höfer, C. G. Jung, Hermann Schmitz und Michael Mehrgardt.
Zum 1. Teil kommst Du über den folgenden Link:
Was bedeutet “dialektisch” in der Philosophie?
In der Philosophie gibt es eigentlich keine einheitliche Definition von dem, was “dialektisch” bedeutet. Dieser Begriff ist sehr vielschichtig.
Wörtlich stammt er vom Griechischen dia (durch) und legein (sprechen),
dialégesthai (ein Gespräch führen): Über den Raum hinweg sprechen, der die Gesprächspartner trennt.
Es gibt viele Traditionen in der Philosophie zum Thema Dialektik, die nicht verbindungslos koexistieren, sondern vielfach verstrickt sind (3). Für wesentlich halte ich hier Sokrates bzw. Platons Verständnis von Dialektik als eine spezielle Kunstform der philosophischen Untersuchung: sie half vom “Sinnlichen zum Verständlichen” zu gelangen (4) und umgekehrt.
Gerhard Faden (8) weist darauf hin, dass Dialektik im Phaidros als Kunst der Trennungen und Vereinigungen definiert wird: “das heißt, sie (die platonische Metaphysik, T.N.) ist weder dualistisch noch monistisch, sondern eben dialektisch.” (Faden, S. 18) – im Klartext: Instanz A und B bilden zwar eine Einheit (Vereinigung), koexistieren in dieser Einheit aber stets fort (Trennungen).
Aristoteles degradiert die Dialektik zu einem bloßen, logischen Nachdenken, das sich auf plausible Meinungen beziehen soll. Dasselbe wird Immanuel Kant vorgeworfen.
Erst für Hegel wird die Dialektik wieder wesentlich. Sie ist für ihn das existenzielle Prinzip, welches dem Denken und der Wirklichkeit zugrunde liegt. Jedes Seiende (Thesis) wird durch sein Gegenstück (Antithese) negiert und verwirklicht sich in der Synthese. Auch Hegel betont, dass die Gegensätze zwar eine Einheit bilden, doch das eine kann nicht ohne das andere existieren - sie bestehen für sich und doch miteinander in der Einheit fort.
Definition von Dialektik
Es geht immer um mindestens 2 beteiligte Instanzen: A und B. Das dialektische Verhältnis besitzt dabei folgende Merkmale (vgl. auch Mehrgardt, 1):
Untrennbarkeit
Das Eine kann nicht ohne das Andere existieren.
Konstitutiven
Beide gründen ihr Sein in dem Sein des jeweiligen Gegenstücks.
jedes A trägt jedes B in sich
und jedes B auch jedes A, da es durch die Negation des Gegenpols in seinem Wesen definiert wird.
vereinen sich beide zu einer dialektischen Einheit
in welcher sie ihre eigene Identität bewahren, sich aber auch mit der anderen vereinen.
Dialektische Menschenbilder
Karl Marx – Erich Fromm – Heiner Keupp & Renate Höfer
Marx' Menschenbild – Historisch-dialektischer Materialismus
Die marxistische Dialektik analysiert historische Entwicklungen und soziale Veränderungen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Kräften und Widersprüchen, wobei sie den Fokus auf die materiellen Bedingungen und die Produktionsverhältnisse legt.
Der Mensch wird als Produkt und Produzent der gesellschaftlichen Verhältnisse gesehen. Gleichzeitig sind gesellschaftliche Verhältnisse und menschliche Beziehungen grundlegend für die menschliche Existenz und Entwicklung des Einzelnen.
Im Zentrum von Marx' Menschenbild stehen die Begriffe "Arbeit" und "historischer Materialismus". Marx verstand die Arbeit als eine zentrale Tätigkeit des Menschen, die ihn von anderen Tieren unterscheidet und die es ihm ermöglicht, die Welt um ihn herum zu gestalten und zu verändern.
Zu seinem Privatleben vgl. Jenny Marx – eine übersehen Denkerin
Im Kapitalismus jedoch wird die Arbeit entfremdet, da die Arbeiter keine Kontrolle über ihre Arbeit oder das, was sie produzieren, haben. Diese Entfremdung führt zu einem Verlust des menschlichen Potenzials und einer Entfremdung von sich selbst, von anderen Menschen und von der Natur.
Marx glaubte außerdem, dass die menschliche Gesellschaft durch Klassenkampf und Veränderungen in der Produktionsweise vorangetrieben wird, was sich wiederum auf das Bewusstsein, die Ideen und das Verhalten der Menschen auswirkt. Der Klassenkampf ist damit der Motor der Geschichte.
Im Gegensatz zu einigen anderen philosophischen Traditionen betonte Marx die Veränderbarkeit und die historische Kontingenz des Menschen. Er glaubte, dass der Mensch kein festes Wesen mit unveränderlichen Eigenschaften ist, sondern dass sich das menschliche Bewusstsein, die Bedürfnisse und die Fähigkeiten im Laufe der Geschichte und im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Bedingungen entwickeln und verändern lassen.
Kritik am marxistischen Menschenbild
Vor allem die marxistische Dialektik ist einem Determinismus verhaftet: einer unvermeidlichen Entwicklung hin zu einer bestimmten Gesellschaftsform – dem Kommunismus.
Diese Perspektive wird allerdings den Rollen des menschlichen Handelns, Willens und Entscheidens nicht gerecht, welche die Geschichte und Gesellschaft prägen.
Erich Fromms humanistisch-sozialistische Charaktertheorie
Erich Fromm bildet laut Mehrgardt (1) eine Synthese von Marxismus und Psychoanalyse. Dabei ging auch Fromm davon aus, dass menschliche Wesen sich durch produktive Aktivitäten in der Welt ausdrücken und ihre Fähigkeiten entwickeln.
Produktive Aktivität umfasst kreative, sinnvolle Arbeit, die es Individuen ermöglicht, sich selbst zu verwirklichen und ihre menschlichen Potenziale zu entfalten. Fromm sah den Menschen als ein soziales Wesen, das auf Gemeinschaft und Zusammenarbeit angewiesen ist.
Er betonte die Bedeutung der Freiheit für die menschliche Entwicklung und das psychologische Wohlbefinden und unterschied zwischen "negativer Freiheit" (Freiheit von äußeren Zwängen) und "positiver Freiheit" (Freiheit zur Selbstverwirklichung und zur Schaffung eines sinnvollen Lebens).
Er schrieb über das Konzept der "Flucht vor der Freiheit", das besagt, dass Menschen, wenn sie mit der Angst und Unsicherheit konfrontiert sind, die mit Freiheit und Autonomie einhergehen, manchmal dazu neigen, sich autoritären Strukturen, destruktiven Verhaltensweisen oder konformistischen Denkweisen zuzuwenden. Diese Flucht vor Freiheit kann dazu führen, dass Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen und stattdessen in selbstzerstörerischen Mustern verharren.
Biophilie und Nekrophilie: Fromm unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Orientierungen im menschlichen Leben: der biophilen Orientierung, die sich durch Liebe zum Leben, zur Kreativität und zur Produktivität auszeichnet, und der nekrophilen Orientierung, die sich durch Destruktivität, Kontrolle und Todessucht auszeichnet. Fromm glaubte, dass ein gesundes Menschenbild auf der biophilen Orientierung beruht.
Kritik an Fromms Menschenbild
Kritiker bemängeln, dass Fromms Konzepte von der menschlichen Freiheit und Verantwortung zu optimistisch und naiv sind und nicht berücksichtigen, dass bestimmte soziale, kulturelle und ökonomische Faktoren den Handlungsspielraum einer Person einschränken können.
Die Identitätspsychologie von Keupp und Höfer
Dies ist ein Ansatz zur Untersuchung der menschlichen Identität, der sich auf die sozialen, kulturellen und historischen Bedingungen konzentriert, die die Entwicklung der persönlichen Identität beeinflussen.
Keupp und Höfer verstehen Identität nicht als feststehende, unveränderliche Eigenschaft, sondern als einen fortlaufenden Prozess der Konstruktion und Aushandlung, der in sozialen und kulturellen Kontexten stattfindet. Die persönliche Identität wird ständig im Austausch mit der Umwelt und den sozialen Beziehungen neu gestaltet. Diese Identitätsentwicklung ist in den sozialen, kulturellen und historischen Bedingungen verwurzelt, die das Leben eines Individuums prägen.
Anstatt einer einzigen, kohärenten Identität gehen Keupp und Höfer von der Existenz multipler Identitäten aus, die in verschiedenen Kontexten und Situationen zum Tragen kommen. Individuen können unterschiedliche Rollen einnehmen und verschiedene Aspekte ihrer Identität in verschiedenen sozialen Situationen betonen.
Die persönliche Identität wird außerdem auch durch die Erzählung von Lebensgeschichten und biographischen Erfahrungen geformt. Individuen konstruieren ihre Identität durch das Erzählen von Geschichten über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und durch das Verknüpfen von persönlichen Erfahrungen mit sozialen und kulturellen Kontexten.
Allerdings findet das Ganze innerhalb von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Diskursen statt, die die verfügbaren Identitätsangebote und -ressourcen beeinflussen. Keupp und Höfer betonen die Bedeutung von Macht und Diskurs für die Aushandlung von Identität und die Möglichkeiten, die Menschen haben, um ihre eigene Identität zu gestalten.
Diskussion – deterministisch & dualistisch anstatt dialektisch
Selbstverständlich besitzen die dargestellten Ansätze durchaus interessante Impulse, insbesondere die sozialkritischen Aspekte sind hier hervorzuheben. Allerdings denken sich die meisten dieser Theorien Dialektik als Widerstreit mitsamt Vereinigung: als A und B lösen sich in C auf.
So ist Dialektik (wie oben beschrieben) im philosophischen Sinne aber nicht gedacht.
Modelle des Zwischen
C. G. Jung – Hermann Schmitz – Michael Mehrgardt
C. G. Jungs kollektives Unbewusste
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts befasste sich Carl-Gustav Jung (1875 – 1961) mit dem Konzept des Unterbewussten. Er erkundete das kollektive Unbewusste, das die Basis für das individuelle Unbewusste bildet, welches von der traditionellen Psychoanalyse erforscht wird. Dieses kollektive Unbewusste ist Teil unserer Natur und gleich bei jedem Menschen.
Jung stellte fest, dass Bilder, Figuren und Geschichten aus den Mythologien der ganzen Welt unverkennbar in Träumen und Fantasien zeitgenössischer Europäer wiederauftauchten, obwohl es keinerlei direkte Kontakte dazu gab. Daher können diese Urmuster, bekannt als Archetypen, nicht im Laufe des Lebens erworben werden, sondern müssen vererbte Strukturen sein.
Diese Archetypen repräsentieren die grundlegenden Themen der gesamten menschlichen Existenz. Jung glaubte, dass jeder Mensch mit einer bestimmten Anzahl von Archetypen in Verbindung steht, die als innere Bilder, Charaktere oder Symbole im Unterbewussten wirken. Diese Archetypen können in Träumen, Mythen, Legenden, Kunst und religiösen Ritualen manifestiert werden.
Einige bekannte Archetypen, die von Jung beschrieben wurden, sind der Held, das Weibliche, das Kind, der Schatten und das Selbst. Jeder Archetyp hat eine eigene Bedeutung und Funktion und kann sowohl positiv als auch negativ ausgeprägt sein.
Kritik an Jungs Menschenbild
Es wird argumentiert, dass Jungs Konzept der Archetypen zu unscharf und allgemein, historisch begrenzt und nicht universell gültig ist.
Insbesondere von feministischer Seite hagelt es berechtigte Kritik: Jungs Konzepte sind patriarchalisch konzipiert. Das Gleiche lässt sich auch in kultureller Hinsicht anführen: Jung berücksichtigte vorwiegend bestimmte kulturelle und ethnische Gruppen.
Hermann Schmitz’ Neue Phänomenologie
Hermann Schmitz hat mit seiner Neuen Phänomenologie (5) große Wellen geschlagen. Wahrnehmung ist für ihn, wie auch in der klassischen Phänomenologie, keine mechanische Rezeption von Signalen, sondern leibliche Kommunikation.
So sind Emotionen zum Beispiel auch keine inneren Prozesse, sondern eher Atmosphären im Raum, die wir aus Gewohnheit nach innen projizieren.
Kurz zusammengefasst:
In der neuen Phänomenologie werden Atmosphären, einschließlich Wetter und Stille, hauptsächlich jedoch Gefühle, als räumlich ausstrahlende Kräfte verstanden, die den menschlichen Körper beeinflussen können.
Eine weitere wichtige Kategorie sind Situationen, die durch Bedeutungen, Sachverhalte, Programmierungen und Probleme konstituiert werden.
Der Begriff "Leib" bezieht sich dabei auf eine Entität, die räumlich ausgedehnt ist, ähnlich wie ein Geräusch, und die prädimensional und unteilbar ist, aber dennoch nicht unstrukturiert. In Schmitz' Perspektive spielt auch die leibliche Kommunikation eine Rolle.
Eine weitere Phänomen-Gruppe, die er einführt, sind die sogenannten Halbdinge, deren Existenz sich auf bestimmte Intervalle beschränkt und die direkte Kausalzusammenhänge haben können.
Schließlich spielt bei Schmitz der Raum eine wesentliche Rolle, jedoch nicht als ein Raum aus relativen Orten, sondern als Raum des Hörens, des Körpers und der Gefühle.
Die Neue Phänomenologie beschäftigt sich mit der Bedeutung der Subjektivität. Sie argumentiert gegen die traditionelle Vorstellung, dass alle Fakten objektiv sein müssen, und zeigt stattdessen, dass es auch subjektive Fakten gibt, die nur von einer Person festgestellt werden können
Auch ist es unter anderem Schmitz zu verdanken, die Rolle der Leiblichkeit wieder in Erinnerung zu rufen.
Kritik an Schmitz' Theorie
Hermann Schmitz' neue Phänomenologie hat keinen unumstrittenen Ruf. Einer der häufigsten Kritikpunkte: seine überheblichen Formulierungen, wie zum Beispiel diese: “In meiner Analyse des leiblichen Befindens setze ich mir - soviel ich sehe, zum ersten Mal in der Weltliteratur - das Ziel, ein abgerundetes Begriffssystem allein auf das Zeugnis des eigenleiblichen Spürens zu gründen, ... ” (Schmitz, zitiert nach Wikipedia)
– Das ist schon eine starke Behauptung. Insbesondere weil inzwischen viele Arbeiten in Tradition der älteren Phänomenologie (Definition) erschienen sind, die diese Behauptung widerlegen.
Auch wird Schmitz unterstellt, in seiner Gefühlstheorie die Subjektivität bzw. Inter-Subjektivität von Gefühlen nicht ausreichend zu würdigen ("Gefühle genauso objektiv sind, wie Landstraßen"). Kritiker, wie Fuchs oder Demmerling, bemerken daher zu Recht eine (verbale?) Objektivierung von Gefühlen.
Letztlich wird Schmitz vorgeworfen in einen cartesianischen Dualismus zu verfallen. Erwähnenswert scheint mir hier die Kritik von Bernhard Waldenfels: dieser meinte, Schmitz' Spürens-Begriff enthalte einen Außenbezug und verlasse die Innendimension bereits, bevor man zur Innenaussage gelange. (7)
Der Phänomenologe Jan Slaby warnt davor: “Gefühle selbst mit Atmosphären zu identifizieren und sie zu “überpersönlichen Mächten” zu erklären” (9).
Mehrgardts unscharfes Selbst
Michael Mehrgardt hat auf Basis erkenntnistheoretischer Diskurse eine Metatheorie des dialektischen Selbst entworfen. (6) Er geht davon aus, dass ein Selbst mit einem anderen Selbst, einem Gegenstand, einer Idee, Umwelt in einen Prozess relationaler Wahrheitsgenese eingeht.
Sein dialektischer Konstruktivismus besagt:
die Welt wird durch menschliche Wahrnehmung und Handlungen konstruiert. Diese Realität ist jedoch nicht statisch, sondern entsteht aus einem ständigen Prozess des Wandels, bei dem sich neue Möglichkeiten und Verhältnisse aus den bestehenden entwickeln.
Laut Mehrgardt kann eine Veränderung in einem Teil des Systems zu einer Veränderung in anderen Teilen führen, was zu einem kontinuierlichen Wandel der Realität führt. Dieser Wandel wird von den Handlungen und Interaktionen zwischen Individuen und Gruppen getrieben.
Konkret beschreibt Mehrgardt ein Inein-andergreifen des Erkennens und Wirkens mehrerer Entitäten. Das Selbst ist kein abgegrenzter Organismus, sondern ein Bereich, in dem Ich und Du, Innen und Außen aufeinander treffen.
“Das Selbst ist deshalb immer hautnah und flüchtig (...) Deshalb können Dogmen niemals wahr sein. Das derart gefasste Selbst öffnet sich, da es mit allem Anderen Überschneidungen und neue Identitäten bzw. Qualitäten bildet, dem Du, der opponierenden Meinung, dem Fremden und Andersartigen, ja, auch kreativen und morphogenetischen Feldern oder Orts- und Zeitgeistern und tritt mit dem jeweiligen Gegenüber in erkennende Interaktion.”
“Jetzt wird deutlich, warum ich dieses dialektische Selbst auch als unscharf bezeichne: Es ist unscharf in dem Sinne ausbleibender gegenseitiger Verletzungen; unscharf ist es darüber hinaus deshalb, weil seine Grenzen nicht eindeutig auszumachen sind, es sei denn als Momentaufnahme von einem konkreten Standpunkt aus.
Eine der wesentlichsten Implikationen dieses Entwurfs ist der Aufweis, dass Standpunkte in den Begegnungen von Selbsten nicht als logisch, erkenntnistheoretisch usw. zwingend begründet werden können; deshalb ist mit „Erkenntnissen“ auch niemals ein Macht- oder Wissensanspruch ethisch gerechtfertigt.
Die unscharfe Metatheorie des Selbst hingegen beinhaltet, dass jeder Standpunkt zwingend eine Stellungnahme ist, also eine Wahl, die zu verantworten ist. Da man nicht keinen Standpunkt einnehmen kann, hat der Mensch im Sartre’schen Sinne nicht die Freiheit, nicht zu wählen. Insofern ist auch diese Selbst-Metatheorie eine Stellungnahme, deren ethischen Schlussfolgerungen ich bezeichne als die Maximen des Sowohl-als-Auch, der Offenheit, der Mächtigkeit, der Weisheit und der Behutsamkeit.” (Mehrgardt, 1)
Mehrgardts Erkenntnistheorie würdigt völlig zu Recht die Erfahrung aller beteiligten Subjekte gleichermaßen. Damit scheint er eine ergänzende Theorie zu liefern, die hervorragend mit anderen phänomenologischen Konzepten des Selbst kompatibel ist.
Fazit: dialektische Menschenbilder
Die meisten phänomenologischen Selbsttheorien haben gemeinsam, dass jede Art und Form von Erfahrung von einer fundamentalen Meinhaftigkeit ausgeht (vgl. Zahavi). Bedeutet: Nur durch ein basales, affektives Selbstgefühl kann etwas für jemanden zur Erfahrung werden.
Das Selbstgefühl zeigt sich mitunter im leiblichen Hintergrundempfinden, Merleau-Ponty nannte das Ur-Subjektivität, Michel Henry benutzte den Begriff Ipseität.
Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Selbst abgegrenzt vor sich hin lebt. Neuere Konzepte rücken viel mehr die Relationalität des Selbst in den Mittelpunkt: Jedes Selbstverhältnis ist zugleich ein Fremd-Verhältnis zu anderen Menschen, von denen das Subjekt affiziert, angesprochen und berührt wird, mit denen es kommuniziert, interagiert und sich selbst entwickelt. Die Selbstentwicklung lässt sich als Dialektik von Aneignung und Abgrenzung denken, Anpassung und Individualisierung etc.
Das Selbst ist intersubjektiv - wie bei Mehrgardt, überlagert sich auch in anderen phänomenologischen Theorien das Selbst mit anderen Selbsten. Es gibt kein Ich, das erst irgendwie zum fremden Anderen gelangen muss.
Vielmehr gibt es ein präreflexives, außersprachliches Selbst, das über zwischenmenschliche Phänomene mit anderen Selbsten in einem direktem Bezug steht.
Quellen:
(1) Michael Mehrgardt: Homo solus – Doxai und Paradoxa des kulturellen Selbstverständnisses. In: Gestalttherapie, 1, 3-25, 2001 (hier auf dem Blog online zu lesen)
(2) Klaus Schneewind: Persönlichkeitstheorien. Bd. 1 u. 2, Darmstadt: Primus 1992.
(3) Metzler Lexikon der Philosophie: Dialektik
(4) PhiloMag: Begriffslexikon - Dialektik
(5) Schmitz, H., 1989: Leib und Gefühl. Paderborn: Junfermann
(6) Mehrgardt, M., 1997: Erkenntnistheorie und Gestalttherapie, Teil 3. In: Gestalttherapie 1, S. 26-42
(7) Thomas Latka: Hermann Schmitz (auf Topologie Wiki – Wissen, rund um Raum-, Orts- und Feldphänomene)
(8) Gerhard Faden: Platons dialektische Phänomenologie. Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg 2005
9) Jan Slaby: Möglichkeitsraum und Möglichkeitssinn, 2016