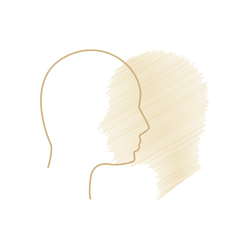Was ist Phänomenologie? (Definition) – über Erleben & Selbst
Die Phänomenologie ist eine Philosophie, die sich mit dem menschlichen Bewusstsein und seinem Erleben beschäftigt. Kurz: sie untersucht die Erfahrungswelt des Menschen. Die Phänomenologie zielt darauf ab, die essentiellen Merkmale von Erfahrungen zu erfassen und zu beschreiben, indem sie Vorannahmen und Interpretationen zu vermeiden versucht.
Die Phänomenologie ist eine bedeutende Strömung
in der Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts, insbesondere von Edmund Husserl definiert. Phänomenologische Ansätze haben viele andere Philosophen beeinflusst, darunter Adorno, Gadamer, Foucault und Habermas. Tatsächlich ist die Phänomenologie damit eine entscheidende Grundlage für die Entwicklung von Hermeneutik, Existenzialismus und humanistischen Psychotherapien.
Inhaltsverzeichnis: Was ist Phänomenologie? +
Philosophische Phänomenologie
Definition & Bedeutung
Der Begriff Phänomenologie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt so viel wie die Wissenschaft vom Sichtbaren oder Erscheinenden.
Die philosophische Phänomenologie geht davon aus, dass das Wesen von Welt, Dingen, Lebewesen und Mensch nicht durch empirisches Beobachten und Messen erfasst werden kann.
Vielmehr geht es darum, wie Phänomene, Situationen, Menschen etc. wahrgenommen werden. Ein zentraler Begriff in der Phänomenologie ist die "Intentionalität", die Fähigkeit des Bewusstseins, sich auf etwas außerhalb von sich selbst zu beziehen.
Was sind Phänomene?
In der Umgangssprache werden Phänomene (Erscheinungen) als etwas verstanden, das im Gegensatz zur Wirklichkeit steht.
Die Erscheinung ist wie ein Schleier, der gelüftet werden müsse, um den wahren Wesenskern zu enthüllen und zu erkennen. Ein Phänomen ist demnach nicht das, was sich darstellt, sondern eben nur eine Erscheinungsform (= Phänomenalismus).
In der Phänomenologie ist die Wirklichkeit von Subjekt und Objekt, also Selbst und Welt, aber nicht getrennt. Im Gegenteil: Hier ist die subjektive Erfahrung die Grundlage überhaupt für jede Art von Erkenntnis und Wahrnehmung.
Phänomenologie der Wahrnehmung
Ein Phänomen ist das, was sich zeigt. Hinter ihm steht nichts, das mehr Sein oder Sinn hätte. Die Erscheinungsformen selbst sind real und mit Bedeutung verknüpft.
Gleichzeitig haben auch Phänomene verschiedene Möglichkeiten zu erscheinen: von einer bestimmten Perspektive aus, bei starker oder schwacher Beleuchtung, nur in der Vorstellung usw.
So kommt es zu wesentlichen Unterschieden in der Wahrnehmung von einfachen Dingen, Musik, Situationen, sozialen Interaktionen usw.
Subjektive Erfahrung als Erkenntnisquelle
Das bedeutet auch, dass die Welt, wie unmittelbar erscheint, die Welt an sich ist. Egal ob ich sie sinnlich wahrnehme oder sie mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden analysiere.
Natürlich sind einige Erscheinungsformen durchaus irreführend. Doch nach phänomenologischer Auffassung geht es nicht um ein Trugbild und ein Wirkliches, sondern um die Art, wie ich dem Phänomen begegne.
Ein flüchtiger Blick auf ein Erscheinendes kann schnell täuschen, eine genaue Betrachtung und Untersuchung die Perspektive komplett ändern.
Die eigentliche Wesensart der Phänomene verbirgt sich also nicht hinter der Erscheinung, sondern entfaltet sich in ihr.
Eine strikte Trennung in Mensch und Welt, Subjekt und Objekt, Innen und Außen wird in der Phänomenologie hinterfragt und als methodisch ungeeignet zurückgewiesen.
Husserls Phänomenologie
Edmund Husserl war ein Mathematiker und Philosoph. Er gilt als Vater der philosophischen Phänomenologie und als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts.
Sein berühmter Leitspruch lautete: Zurück zu den “Sachen selbst!” Das Ziel: Die Welt so zu verstehen, wie sie auch vom handelnden Menschen selbst erfahren wird.
Es geht um Alltagskonzepte, mit denen ein Mensch täglich Probleme und Geschehnisse auffasst und deutet. Dabei dachte Husserl sich den Anfang der Erkenntnisgewinnung im Unmittelbaren. Husserl benutzte dafür den Begriff “Intentionalität” – nicht im Sinne von konkreter Absicht, sondern in der Ausrichtung des Bewusstseins auf die Welt.
Die Welt besteht nicht losgelöst vom menschlichen Bewusstsein, sie existiert nicht „an sich“. Die Welt, in der ich lebe, existiert gleichzeitig mit meinem Bewusstsein in Sinnbezügen.
Intentionalität & Lebenswelt
Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von etwas
Das bedeutet, mein Bewusstsein ist immer auf etwas gerichtet. Zum Beispiel ist es möglich, eine Rose als wunderschön und duftend zu erleben, während ein anderer Mensch sie als dornig und gefährlich wahrnimmt. Die Intentionalität ist also ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Wahrnehmung und Erfahrung.
Sie ermöglicht es, nicht nur “objektive” Eigenschaften von Dingen wahrzunehmen, sondern auch subjektive Erfahrungsqualitäten und Bedeutungen.
Für Husserl war das Verhältnis von Welt und Bewusstsein komplementär. Es gibt keinen Vorrang von Welt oder Selbst, sondern eine “Gleichursprünglichkeit”. Das eine kann nicht ohne das andere gedacht und erfahren werden.
Generalthesis der natürlichen Einstellung
Zentrale Ausgangslage von Husserls Philosophie ist die “natürliche Einstellung zur Welt”, der unbewusste Glaube, dass Wirklichkeit objektiv sei.
Diese Annahme ist als "Generalthesis der natürlichen Einstellung zur Welt" bekannt. Um zu den Dingen selbst zurückzugelangen, fordert er die bewusste Ablösung von Vorwissen über die Welt.
Diesen Prozess nannte er Epoché: Sie sollte helfen, die Welt abgelöst von eigenen Interessen, Vorurteilen und Konzepten in der Wahrnehmung eines anderen zu betrachten.
Die phänomenologische Methode
Mit der phänomenologischen Methode versucht man eine systematische Beschreibung und Analyse der Strukturen bewusster Erfahrung zu finden, um so zu einer objektiven Erkenntnis der erfahrbaren Welt und dem Wesen der Dinge zu gelangen.
In der Regel handelt es sich um einen 3-Schritt:
Die Reduktion: Hierbei werden alle Vorkenntnisse und Annahmen über das zu untersuchende Phänomen suspendiert.
Die Intuition: Durch eine genaue Beschreibung der Phänomene auf der Basis von direkter, unmittelbarer Erfahrung sollen ihre wesentlichen Eigenschaften offengelegt werden.
Die Analyse: Anhand der intuitiven Beschreibungen werden die Strukturen der Phänomene identifiziert und analysiert. So soll das Wesen eines Phänomens erkannt und beschrieben werden.
Die phänomenologische Methode hat nicht nur in der Philosophie, sondern auch in anderen Bereichen, wie z.B. der Psychologie oder der Soziologie, Anwendung gefunden.
Heideggers Phänomenologie
Dasein & Befindlichkeit
Martin Heidegger war deutscher Philosoph in der Tradition der Phänomenologie Husserls sowie der Existenzphilosophie Kierkegaards.
Auch er übte grundlegende Kritik an der Philosophie seiner Zeit und betonte die Unzertrennlichkeit von Welt und Mensch: die Welt gibt es nicht unabhängig vom Menschen, vielmehr wird sie durch sein praktisches Handeln und Denken mitgestaltet.
Heidegger betont zudem, dass die Welt für den Menschen nicht einfach ein neutraler Hintergrund ist. Die Welt hat für den Einzelnen eine Bedeutung, die über ihre bloße, physische Existenz hinausgeht, und diese Bedeutung ist eng mit dem menschlichen Handeln und Denken verbunden.
Auf den Punkt gebracht: Der Mensch lebt nicht nur in der Welt, sondern ist auch Teil der Welt.
Das menschliche Dasein ist nicht nur eine Sache unter vielen – es ist einzigartig, weil es sich seiner selbst bewusst ist und sich in Beziehung zur Welt setzen kann. Heidegger nennt diese Beziehung und damit Grundkonstitution der menschlichen Existenz: "Sorge ums Dasein".
Leib-Phänomenologie nach Merleau-Ponty
Maurice Merleau-Ponty war ein französischer Philosoph des 20. Jahrhunderts und einer der Begründer der Leibphänomenologie, die heute in Embodiment-Konzepten wiederauflebt.
Im Gegensatz zu Husserl und Heidegger wollte Merleau-Ponty einen 3. Weg bieten, um den essentiellen Zusammenhang des menschlichen Daseins und der Welt aufzudecken. Merleau-Ponty betonte die Bedeutung des Körpers als integralen Teil der Wahrnehmung und des Verständnisses von Raum und Zeit.
Damit ist der menschliche Körper kein isoliertes Objekt, sondern vielmehr Teil eines lebendigen Beziehungsnetzes mit der Welt um sich herum.
Körper haben, Leib sein
Der Leib ist nach Merleau-Ponty im Zwischenbereich von Selbst und Welt angesiedelt. Er besitzt eine grundsätzliche Ambiguität, weil er weder reines Ding (Physis) noch reines Bewusstsein (Psyche) ist.
Leiblichkeit bezeichnet in der Leibphänomenologie gerade nicht den Körper, sondern den Sitz der Aktivität, Willensbildung und Stimmung.
Doch ist der Leib Einheit, dann lässt er sich nicht in Schichten und Instanzen zerteilen, denn nur das Ganze erzeugt Wesen und Sinn.
Dadurch wird jede Trieb- und Kausalpsychologie unzulänglich. Stattdessen forderte Merleau-Ponty, man solle menschliches Verhalten nicht auf Komplexe und Triebe reduzieren, sondern als Positionierung zum Leben verstehen.
Das Subjekt in der Phänomenologie
Die Rolle des Selbsterlebens
Während in den empirischen Wissenschaften Begriffe wie Selbst, Subjektivität oder Dasein keine Rolle spielen, sind sie in der Phänomenologie von entscheidender Bedeutung.
Das Subjekt bzw. das subjektive Bewusstsein ist deshalb so wichtig und darf nicht übergangen werden, weil es die Basis und Perspektive anlegt, in welcher Weise die Welt erscheint und Bedeutung erhält.
Das gilt auch für die Wissenschaften:
den Forschern selbst erscheint ja alles perspektivisch, die eigene Perspektivität ist daher der notwendige Ausgangspunkt und darf nie übersehen werden. Der Mensch ist nur in seinem Verhältnis zur Welt verstehbar und die Welt nur im Verhältnis zum Subjekt.
Die Privatheit mentaler Zustände
Die Phänomenologie geht daher von einer unzertrennbaren Verbindung von Subjektivität und Welterfahrung bzw. Mensch und Welt aus.
Schlussfolgerung: eine Interpretation von außen (3. Person-Perspektive) bleibt defizitär, da die subjektive Erfahrung (1. Person-Perspektive) mit einem besonderen Erkenntnisvorgang verbunden ist (Privatheit mentaler Zustände).
Der Mensch gewinnt durch und in der Erfahrung ein unmittelbares Wissen über diese einzigartige Erfahrung, die kein anderer Mensch in vollkommen gleicher Art und Weise machen kann.
Das Selbstgefühl als Basis
Für die Aussagekraft der Subjektivität spricht auch das Selbstgefühl, das jedem Menschen eigen ist:
Ich habe von Anfang an und grundlegend den Eindruck, dass es sich um meine eigenen Gefühle handelt, die ich spüre.
Ich weiß, dass ich in meinem Leib lebe.
Auch weiß ich, dass ich es bin, die etwas tut, sagt, denkt etc.
Das alles zeugt von einer basalen Selbst-Erfahrung, die nicht einfach übergangen werden darf.
Subjektivität als Grundlage der Erfahrung
Die Phänomenologie betont den subjektiven Zugang zur Wahrnehmung und Erfahrung von Wirklichkeit.
Damit einher geht eine Kritik an einer rein naturwissenschaftlichen Herangehensweise, die lediglich das als wirklich gelten lässt, was in einer reinen, mathematisch-physikalischen Art untersucht werden kann bzw. quantifizierbar ist.
Der sogenannte "Eliminative Materialismus" argumentiert, dass Bewusstsein könne vollständig auf physiologische Prozesse im Gehirn zurückgeführt werden. Einen hinreichenden Beweis für diesen Reduktionismus kann die Neurobiologie allerdings nicht liefern.
Das Dilemma in der Psychologie liegt in ihrem Selbstverständnis als Naturwissenschaft, doch ihr Gegenstand sind eigentlich subjektive und intersubjektive Phänomene. Auf diese Weise forscht die Psychologie nicht nur an der Psyche vorbei, sie überschreitet arrogant auch ihre eigenen Grenzen.
Menschen lassen sich nicht über Zahlen, Physiologie und Mechanismen definieren. Ein solcher Ansatz verkennt die Einzigartigkeit des Individuums und beraubt den Menschen seiner Würde.
Phänomenologie & Psychologie
Phänomenologisch betrachtet ist das Bewusstsein irreduzibel
Eine rein naturwissenschaftliche Sichtweise auf das Bewusstsein, die sich auf die Untersuchung der neurologischen Prozesse konzentriert, kann das Bewusstsein und die Interaktion zwischen Individuen nicht vollständig erfassen.
Eine solche Sichtweise eliminiert das subjektive Element aus der Wissenschaft und ignoriert die Tatsache, dass jedes Phänomen eine Erfahrung für einen Menschen ist und daher auch eine emotionale Bedeutung hat.
Der Psychotherapeut Werner Eber gibt ein sehr schönes Beispiel:
“Was ist Wasser? Wenn wir diese Frage nur naturwissenschaftlich stellen, dann wären mögliche Antworten z.B.: Wasser ist chemisch betrachtet H2O, es existiert in drei unterschiedlichen Aggregatzuständen, es gefriert bei 0 Grad und kocht bei 100 Grad usw.
Dies ist aber nur eine Perspektive von beliebig vielen. Für einen Koch kann Wasser z.B. ein Bestandteil einer Sauce sein. Für einen Wüstenbewohner ist es eine wertvolle Ressource zum Überleben. Für einen Gärtner ist es ein Mittel zur Pflege seiner Pflanzen. Für einen Schwimmer ist es das Medium, in dem er seinen Sport betreibt.
Für einen Phänomenologen sind all diese Perspektiven gleichberechtigt, und die naturwissenschaftliche Perspektive ist nur eine unter beliebig vielen und den anderen weder überlegen noch vorzuziehen.” (4)
Die Qualität der Erfahrung
Es existieren viele Empfindungen und Facetten in der menschlichen Wahrnehmung, die nicht durch objektive Merkmale beschrieben werden können, sondern nur durch subjektive Empfindungen.
Diese subjektiven Erlebnisse sind nicht auf objektive Merkmale beschränkt, sondern können allein durch die subjektive Perspektive des Individuums erfasst werden.
Es geht um das “Wie” der Erfahrung, nicht um das “Was”
Erfahrungen, insbesondere das Erleben von Empfindungen, Gefühlen und Stimmungen, besitzen eine Erfahrungsqualität, die sich auf bestimmte Art und Weise für jemanden anfühlen.
Evtl. auch interessant für dich: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker – Wachstum nach Trauma?
Die Einzigartigkeit der Erfahrung
In der Phänomenologie nutzt man für diese Erfahrungsqualitäten den Begriff "Qualia". Qualia sind alle möglichen Erlebnisqualitäten. Zum Beispiel Emotionen, wie Angst, Freude oder Wut. Oder Sinneseindrücke, wie der Anblick eines Sonnenaufgangs oder der Geschmack von Schokolade.
Auch wenn ich diese Erlebnisqualitäten irgendwie verbal beschreiben kann (meist durch Vergleiche), ist das nicht dasselbe, wie sie selbst zu erfahren.
Verbindung von Welt-Mensch-Mitmensch
Wichtig ist vor allem, dass die Umwelt nie leer ist, sondern immer schon angefüllt mit Qualitäten ist, die ausdrücken, auffordern und auf mich einwirken.
Gefühle und Stimmungen als Seinsweisen
In der Phänomenologie werden Gefühle als Erfahrungen betrachtet, die sich durch ihre spezifische Qualität, Intensität und Dauer auszeichnen. Gefühle sind Teil des subjektiven Erlebens und eng mit Wahrnehmung und Bewusstsein verbunden.
Phänomenologisch gesehen sind Gefühle keine objektiven Eigenschaften der Welt, sondern sie entstehen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt und sind von dessen jeweiligem Horizont geprägt. Das bedeutet, dass Gefühle keine einfachen Reaktionen auf äußere Ereignisse sind.
Gefühle oder Stimmungen befinden sich nicht in einem Innenraum (der Psyche). Sie sind auch keine marginalen Prozesse oder Begleiterscheinungen biologischer Vorgänge, sondern “zentrale Vollzugsformen der personalen Existenz selbst.” (3).
Was auch immer ich oder ein anderer Mensch erlebt, tut oder wahrnimmt, wird nicht von Gefühlen eingefärbt, sondern erfolgt im und durch das Fühlen.
Meine Aktivitäten, Handlungen, Gedanken und Einstellungen lassen sich nicht von Gefühlen trennen.
Emotionalität bzw. Affektivität ist es, die mir und den Dingen in der Welt Bedeutung, Wert, Qualität und Essenz verleihen. Das bedeutet, Gefühle sind keine Form von Werturteilen, sondern eine Konstitutive von Bedeutsamkeitserfahrungen.
„In unserer Lebenserfahrung sind die Gefühle und das leibliche Befinden die Faktoren, die merklich dafür sorgen, dass irgend etwas uns angeht und nahegeht. Denken wir sie weg, so wäre alles in neutrale und gleichmäßige Objektivität abgerückt.“
Fazit: Was ist Phänomenologie?
In philosophischer Hinsicht gehen die heutigen Wissenschaften, insbesondere die Psychologie, von zweifelhaften Voraussetzungen aus: einer grundsätzlichen Zweiteilung der Wirklichkeit (= Dualismus) in Ich und Welt, Geist und Körper, Verstand und Gefühl.
Die phänomenologische Philosophie sieht Lebewesen hingegen als strukturelle Einheit: als Einheit von Ich, Welt und Mitmensch, die sich in ständiger Wechselwirkung aufeinander beziehen.
Die Welt ist nichts Äußeres, das dem Inneren des Menschen gegenüber steht. Mensch und Welt, Verstand und Gefühl, Geist und Leib sind konstitutiv füreinander und können nicht entflechtet werden.
Siehe auch Angst erleben – die phänomenologische Struktur der Angst.
Quellen:
(1) Metzler Lexikon der Philosophie: Phänomenologie
(2) Dan Zahavi: Phänomenologie für Einsteiger
(3) Jan Slaby: Möglichkeitsraum und Möglichkeitssinn
(4) Werner Eberwein: Was ist Phänomenologie?
(5) Hermann Schmitz: Neue Phänomenologie