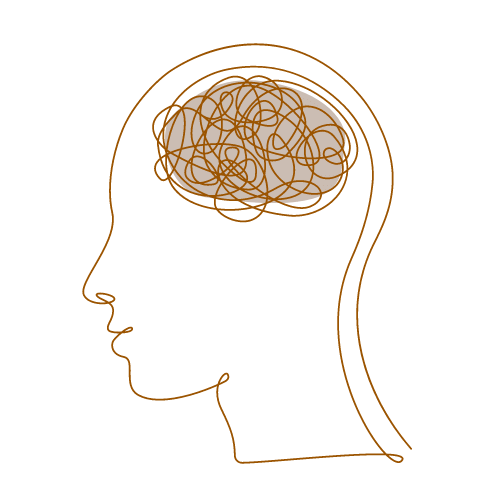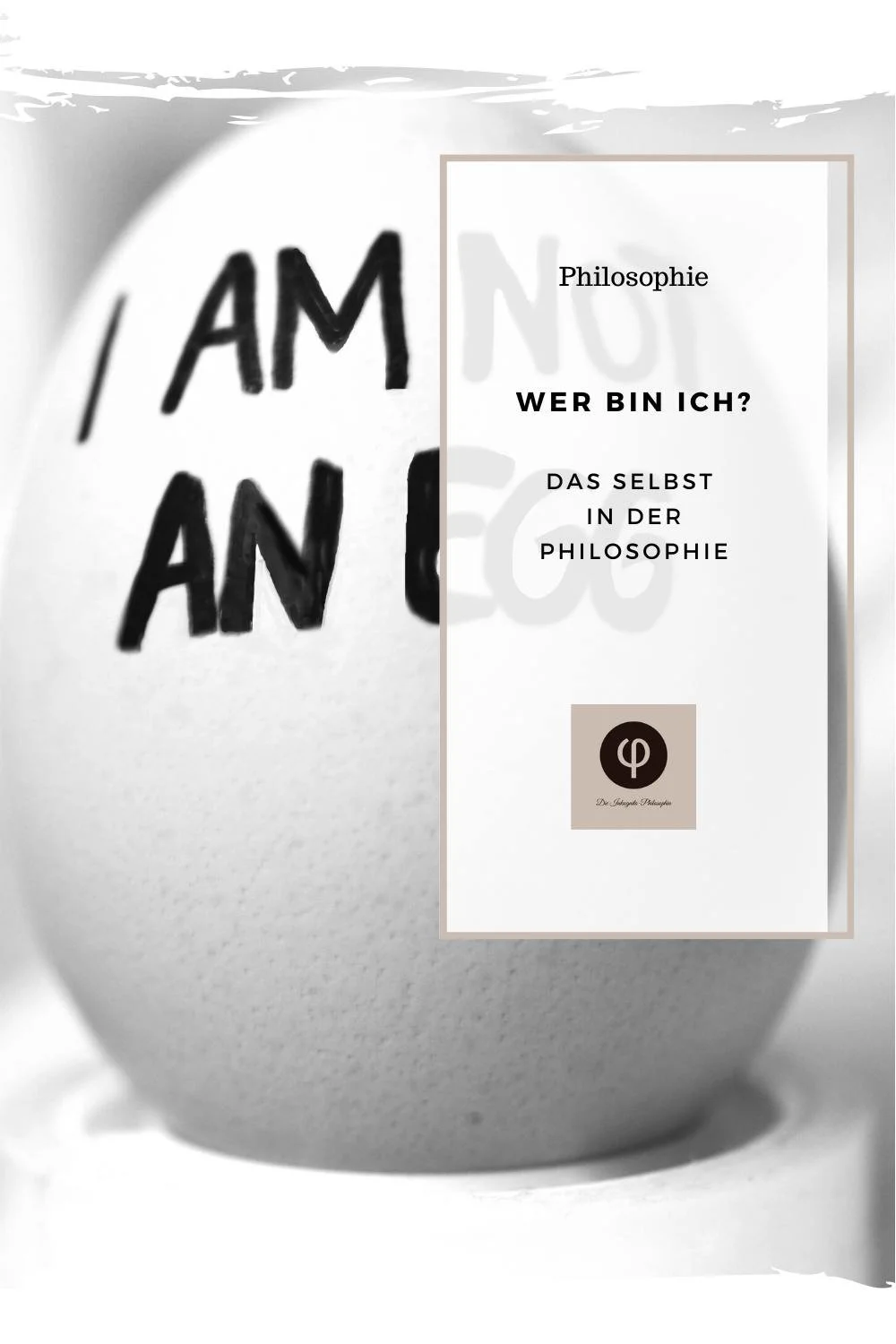Wer bin ich? – Philosophie: Das Selbst, Ich & Identität
“Wer bin ich?” ist eine der großen Fragen des Lebens. Selbstfindung bzw. Selbsterkenntnis ist keine Idee der Neuzeit, sondern begegnet uns seit vielen Jahrhunderten in verschiedensten Facetten. Doch was versteht man unter der Frage “Wer bin ich?” Wo sitzt das Selbst überhaupt? - im Körper oder irgendwo anders? Und wer ist dieses Selbst bzw. Ich?
Was bedeutet "Wer bin ich?"
Du wirst hier keine Antwort erhalten, wer Du bist. Aber Du kannst Dir durch diesen Text bewusst werden, dass die Frage auf andere Weise beantwortet werden muss als mit einem plumpen Fragenkatalog über Deine Stärken, Interessen und Werte.
Inhaltsverzeichns:
Wer bin ich? – Philosophie: Das Selbst, Ich & Identität
Die Suche nach dem Selbst: Wer bin ich wirklich?
Wer ist “Wer” und was ist “Ich”?
Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?
Biologische Psychologie – Das Ich als Nebenphänomen
Wer bin ich und warum?
Diese “Wer bin ich?”-Fragen bringen Dich nicht weiter
Plutarchs Theseus-Paradoxon
Wie lassen sich Identität und Veränderung beim Menschen vereinbaren?
Woher weiß ich, dass ich ein Selbst bin?
Was ist das Selbst?
Descartes - Ich bin Geist
Wittgenstein - Ich bin Sprachkonstrukt
Neurobiologie – Ich bin Illusion
Neuere Philosophie – Das Selbst ist real
Selbstsuche: Wer bin ich wirklich?
Die Frage nach der eigenen Identität, dem eigenen Selbst, zählt zusammen mit “Was ist der Sinn des Lebens?” zu den wichtigsten Themen im Leben eines Menschen.
Bin ich eine Seele, also Geist?
Oder bin ich mein Körper, also eine komplexe Verbindung von Molekülen?
Gibt es mich wirklich oder bin ich eine Illusion?
Wie alt das Sujet ist, zeigt die Überlieferung vom antiken Tempel des Apollon auf Delphi, den der altbekannte Weisheitsspruch zierte: "Erkenne dich selbst”.
Sehr viel später wurde dann Descartes Ausspruch “Ich denke, also bin ich” maßgeblich. Einen Konsens gibt es bis heute nicht wirklich. Wenn Du Dir die Frage mal genauer ansiehst, dann verstehst Du auch, warum sie so schwer zu beantworten ist.
Wer ist “Wer” und was ist “Ich”?
Wer ist mit "Wer" gemeint?
Du, jetzt in diesem Augenblick? Oder die Person, die Du in 20 Jahren sein wirst oder willst? Was genau macht eine Person aus und was nicht?
Wann ist "bin"?
Dein Sein verändert sich mit Deinem Leben. Um welchen Zeitpunkt geht es? Letzte Woche, heute oder in 2 Jahren?
Was ist "Ich"?
Was für ein Sein ist dieses Ich? Bist Du Dein physischer Körper? Bildet sich Dein Ich aus Deinen Wünschen oder Erfahrungen? Wo ist dieses Ich?
Bin ich ein Selbst oder mehrere Selbste?
Die Frage “Wer bin ich?” wird heute inflationär gestellt.
Dabei war das Thema rund 2000 Jahre für die meisten Menschen relativ klar: Ich habe ein "Ich" in mir, das der Welt gegenübersteht (Dualismus). Diese feste Überzeugung trauten sich nur wenige zu kritisieren (vgl. Spinoza, Hume).
Bewegung kam schließlich zum Ende des 19. Jahrhunderts in das Thema: Der Psychologe & Philosoph William James trennte das Ich vom Selbst.
Das Ich sei der dunkle Bewusstseinsstrom, mit der die Umwelt erfahren wird.
Das Selbst sei die Beurteilungszentrale, die diesen Bewusstseinsstrom deutet und wertet.
Spätestens aber seit Freud, der auf James aufbaute, gilt: “Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus.” Das Ich wurde zum Es (dunkler Trieb), das Selbst zum Über-Ich. Dazwischen das echte Ich des Menschen.
Biologische Psychologie – Das Selbst als Nebenphänomen
Von der modernen Hirnforschung wird die Existenz des Ich komplett verworfen. Alles nur ein geistiges Konstrukt, als Neben-Phänomen von physiologischen und neurobiologischen Prozessen.
Vgl. auch Geist und Gehirn – Ich ist nicht Gehirn
Denn verschiedene Bestandteile des Ich (Zeitempfinden, Erinnerung, Körpergefühl etc.) spielen sich in verschiedenen Gehirnregionen ab (1). Neuere Untersuchungen sollen außerdem auf Ich-freie Erlebnisse verweisen (4).
Ganz so einfach ist die Frage nach dem Ich aber nicht beantwortet. Die Neurowissenschaften verwechseln Korrelationen mit Kausalitäten.
Das Selbstgefühl ist real
Doch nur, weil sich das Ich nicht neurologisch an einem zentralen Areal festmachen lässt, bedeutet das längst nicht, dass kein Ich existiert.
Schließlich gibt es über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die wie selbstverständlich “ich” sagen und ein basales Selbstgefühl empfinden, das wesenhaft zu ihrer Person gehört.
Wer bin ich und warum?
Die Suche nach dem eigenen Selbst wird heutzutage leider stark vereinfacht und steht unter dem Prinzip der Selbstoptimierung: Die Frage “Wer bin ich?” wird auf Schwächen, Wünsche und Stärken reduziert, um erfolgreicher zu sein und Ziele zu erreichen.
Gerade Coaches, Psychologen und Psychotherapeuten werben für diese Art der Selbsterkenntnis.
Zu fragen, „Wer bin ich?“ hat aber im philosophischen Sinne überhaupt nichts mit Leistung oder Können zu tun, sondern mit Deinem Wert und Sein als Mensch.
Diese “Wer bin ich?”-Fragen bringen Dich nicht weiter
Die meisten Online-Texte zum Thema “Wer bin ich?” listen oberflächliche Fragen auf, wie zum Beispiel diese:
Was ist meine größte Stärke?
Was ist mein größter Erfolg?
Wofür haben mich andere Menschen gelobt?
Worin bin ich besser als andere?
Worum beneide ich andere Menschen?
Wann hatte ich zuletzt richtig große Glücksgefühle?
Was und wen brauche ich, damit es mir gut geht?
Zu welchem Thema lese ich viel?
Worüber unterhalte ich mich gerne?
Über was möchte ich gerne mehr im Austausch mit anderen erfahren?
Das große Manko an dieser Art von Fragestellung: Du orientierst Dich ausschließlich nach außen. Nicht Dein Selbst wird hier abgefragt, sondern Dein Selbstideal und Dein Fremdbild. Diese Art des Selbstverhältnisses bietet allerdings keine Annäherung an Deine Identität, sondern birgt die Gefahr der Selbstentfremdung.
Plutarchs Theseus-Paradoxon
-
Seele, Ich, Identität – welchen Begriff Du auch nimmst, es bleibt kompliziert. So kompliziert, dass der griechische Historiker Plutarch bereits in der Antike die Erzählung von Theseus' Schiff prägte und so die Schwierigkeit des “Wer bin ich?” aufzeigte (2).
Das Schiff des Theseus (auch Theseus-Paradoxon genannt) behandelt die Frage, ob ein Objekt seine Identität verliert, wenn einige Einzelteile oder sogar alle einzelnen Bestandteile erneuert oder ausgetauscht werden.
Hintergrund: Theseus gilt als mythischer Gründer und König von Athen. Er besiegte den Minotaurus auf Kreta und rettete Griechenland aus der jahrelangen Abhängigkeit von König Minos. Mit dem Schiff kehrte er zurück nach Athen.
Dieses geschichtliche Ereignis feierten die Athener jedes Jahr: Mit dem (angeblichen) Originalschiff des Theseus wurde die Reise nachgestellt. Gute 1000 Jahre lang. Natürlich kamen über diese Jahrhunderte auch Abnutzungserscheinungen auf, so dass immer wieder Teile des Schiffes repariert und ausgetauscht werden mussten.
Plutarch fragte sich: Wie kann jeder einzelne Teil einer Sache ersetzt werden und trotzdem bleibt es dasselbe?
-
Einige würden sagen, es gab in 1000 Jahren nur ein Schiff des Theseus, und weil die Veränderungen allmählich vorgenommen wurden, hat es nie aufgehört, das legendäre Schiff zu sein. Selbst wenn das frühere und das “heutige” Schiff kein einziges gemeinsames Teil mehr besitzen.
Also ist A gleich B.
-
Andere aber könnten argumentieren, dass Theseus das Schiff B nie betreten habe, und dass seine Präsenz auf dem Schiff ein wesentliches qualitatives Merkmal darstelle. Obwohl die beiden Schiffe also zahlenmäßig gleich sind, sind sie qualitativ unterschiedlich. Deshalb ist A nicht gleich B.
-
Daneben lässt sich noch eine 3. Möglichkeit denken. Nehmen wir an, jemand sammelt alle Originalteile des Schiffes von Theseus, die ausgetauscht wurden, und baut sie wieder zu einem Schiff zusammen.
Jetzt gibt es 2 Schiffe zum gleichen Zeitpunkt: Dasjenige, welches Theseus nutzt, und das, welches aus den alten Originalteilen zusammengebaut wurde. Welches dürfte nun wirklich das Schiff von Theseus sein – das funktional oder materiell Gleiche?
Übertragen auf den Menschen lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen:
Wie lassen sich Identität und Veränderung beim Menschen vereinbaren?
1) Materielle Gleichheit begründet Identität
In vielen Bereichen gilt: was aus gleichem besteht, ist das gleiche. Aber wie ist es dann, wenn materielle Teile Deines Körpers ausgetauscht werden, zum Beispiel wegen einer Organtransplantation - bist Du dann nicht mehr Du?
Oder nehmen wir die Veränderung des Äußeren über die Zeit: Macht Dich das Altern, während dem Zellen absterben und teilweise erneuert werden, zu jemand gänzlich anderen?
2) Funktionalität als Basis für Identität
Wir könnten auch voraussetzen, dass es nicht auf das Material, sondern die Funktion ankommt. Solange Du eine funktionelle Einheit (“So-Sein”) bildest und bleibst, bist Du ein spezifisches Ich. Völlig egal, wie sehr Du Dich körperlich oder geistig veränderst.
Unterschied: Konstitution vs. Identität
Wesentlich für die Frage “Wer bin ich” ist daher die Unterscheidung zwischen dem Aufbau eines Menschen und den notwendigen Bedingungen, damit seine Existenz weiter bestehen kann.
Kurzum: Es macht einen Unterschied, ob ich nur das Material betrachte (Konstitution), aus dem etwas besteht, oder ob ich nach einem funktionellen Wesensmerkmal frage (Identität).
Selbst wenn sich die Körperzellen eines Menschen über sein ganzes Leben hindurch erneuern, so ist es doch immer der gleiche Mensch: eine bestimmtes Sein - nicht irgendein oder irgendwer anderes.
Woher weiß ich, dass ich ein Selbst bin?
Nach interdisziplinärem Wissensstand geht man davon aus, dass jeder Mensch ein grundlegendes Selbstgefühl besitzt, das sich aus folgenden Facetten bildet:
Ich empfinde meine eigenen Körperteile als zu mir gehörig
Ich habe das Gefühl, selbstverantwortlicher Urheber meiner Handlungen zu sein
Ich erfahre die Welt, deren Zentrum ich bilde und von dem aus ich mir die Welt erschließe
Ich erkenne mich selbst als Objekt im Spiegel und kann mich von anderen unterscheiden
Ich kann mein eigenes Wissen vom Wissen anderer Personen unterscheiden und mich in andere hineinversetzen (Empathie, Zwischenmenschlichkeit)
Was ist das Selbst?
Descartes – Ich bin Geist
Der Philosoph René Descartes (1596 – 1650) formulierte das berühmte "Cogito"-Argument: Ich denke, also bin ich. Im einfachsten Sinne bedeutet der Satz: Wenn ich denke, muss es mich wirklich geben. Weiterhin argumentiert Descartes über die Vorstellungskraft: Meine Nicht-Existenz kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, ohne Körper zu sein. Das denkende Ich ist also reiner Geist.
Das Problem: Sind Geist und Welt denn wirklich getrennte Entitäten? Gerade die Psychosomatik zeigt, dass ein Subjekt untrennbar an den Leib gebunden ist. Und auch ich selbst erlebe mich als wesenhafte Einheit.
Wittgenstein – Ich bin ein sprachliches Konstrukt
Wittgenstein (1889 – 1951) war ganz anderer Meinung als die Nachfolger Descartes´. "Ich bin meine Welt", schreibt er im "Tractatus logico-philosophicus". Wittgenstein verstand das Ich als sprachliches Konstrukt.
Die Frage “Wer bin ich?” ist ein Sprachspiel. Der Ausdruck "ich habe Schmerzen" ließe sich einfach mit “Aua” beschreiben. Das Wort “Ich” sagt in diesem Satz also nichts aus, sondern sei Ausdruck einer Empfindung.
Das Problem: Sein Vergleich weist einen großen Logikfehler auf: der Ausruf “Aua” enthält eine andere Bedeutung als die Aussage “Ich habe Schmerzen.”
Noch wichtiger: Lässt sich eine sprachliche Regelung einfach so auf die Struktur von Welt oder Geist übertragen?
Neurowissenschaften – Ich bin eine Illusion
Da die Hirnforschung in Zeiten einer positivistischen Wissenschaft vom biologische System Gehirn ausgehen, hat sich inzwischen die Meinung verbreitet, dass Ich sei nur eine Fiktion neurobiologischer Prozesse.
Hier ist natürlich auch ein Dualismus vorausgesetzt: die Trennung von Wirklichkeit und Gehirn-Ich, das sich die Welt als mentale Repräsentation erzeugt.
Auch das ist allerdings eine hoch umstrittene Annahme, die nur unter reduktionistischen und materialistischen Voraussetzungen Sinn macht.
„Das Selbst ist kein Objekt, das schon da ist, um gefunden zu werden“
Neuere Philosophie – Ich bin real
Unter Berücksichtigung psychologischer und neurowissenschaftlicher Ergebnisse kommt die moderne Phänomenologie auf ganz andere Schlüsse über das Selbst (5) als die empirischen Wissenschaften.
Die Selbsterfahrung gründet auf einer ich-bezogenen Einheit des Erlebens. Ein basales Selbsterleben, das sich in der Ich-Perspektive (1.-Person-Perspektive) ausdrückt.
Darüber hinaus bezeichnet das Selbst aber auch eine Persönlichkeit, die trotz aller Wandlungen und Umbrüche des Lebens konstant bleibt.
Was von der Antike bis ins 19. Jahrhundert als Seele begriffen wurde, bezeichnete man später als Ich. Während Freud noch von einem Über-Ich sprach oder Husserl über ein Ich-Zentrum philosophierte, nutzen heutige Autoren lieber den Begriff des Selbst.
Anstelle eines selbstbewussten, stetigen und souveränen Ichs ist ein vielschichtiges, sich langsam entfaltendes Selbst getreten, das erst sein Ich-Bewusstsein erwerben muss.
Wer das Ich betont, weist außerdem auf die Grenze zum Du hin, auf die Abgrenzung zum Anderen.
Genau das ist nach philosophisch-phänomenologischer Theorie nicht die richtige Ausgangslage. Das Selbst ist zwar für sich, doch immer bezogen auf die anderen.
Das ist ein wesentlicher Unterschied zu früheren Vorstellungen des Selbst als einzelnes, abgegrenztes Ich-Bewusstsein.
Ein Selbst befindet sich vor jeder Wahrnehmung bereits in einem Feld aus leiblichen und sprachlichen Beziehungen zu anderen Menschen. Dass es andere Menschen gibt, brauche ich mir nicht zu denken. Mir ist dieses Wissen unmittelbar gegeben.
“Selbstsein ist kein Konstrukt, sondern unsere jeweils grundlegende Realität” (Fuchs)
Das Selbst ist eben nicht eine konsistente Substanz, sondern eine prozesshafte Einheit des Selbsterlebens.
Kein geistiges Konstrukt, sondern eine präreflexive Basis der Identität.
Ebenso wie ich in meiner Wahrnehmung die Existenz und Sichtweise der anderen vorweg nehme, genauso gibt es eine wesenhafte Selbsthaftigkeit.
Eine basale Vorstufe des Bewusstseins darüber, dass mir ganz allein diese Erfahrungen, Handlungen, Gedanken und Gefühle angehören und nicht einem anderen Menschen.
Das Selbsterleben umfasst dabei die Erfahrungshorizonte der Leiblichkeit und Zeitlichkeit. Ich bin mir selbst gegenwärtig in Form von einer leiblichen Selbsterfahrung. Doch ich erfahre auch mein Dasein & Bewusstsein in einem zeitlichen Zusammenhang, der konstitutiv für das Selbst ist.
Wer bin ich und wer bist Du?
Gleichzeitig benötigt ein Selbst auch soziale Kontake, um sich über zwischenleibliche Resonanzen zu einem Selbst auszubilden.
Das Selbstbewusstsein steht durch Kultur, Gesellschaft, Milieu immer in einer Beziehung zu anderen, denn auch angeeignete Fähigkeiten, Stile oder Rollen fließen ins Selbstgefühl mit ein.
Es gibt noch eine weitere Dimension, die einen notwendigen Bestandteil des Selbst bildet: die narrative Identität. Vgl. auch das Gute im Menschen & die Macht der Narrative
In der sprachlichen Interaktion und im Erzählen verbindet der Mensch seine Erfahrungen zu einer Lebensgeschichte. Allerdings spielt dabei nicht nur die Vergangenheit eine Rolle, sondern auch das Selbstkonzept, also das Wissen über meine persönlichen Eigenarten und Eigenschaften.
Fazit: Wer bin ich?
Das Selbst in der Philosophie
Die Frage "Wer bin ich?" kann also nur auf einen Moment bezogen werden.
Mit Jaspers gesprochen, lautet die Antwort: Du bist Weg.
Du bist im Prozess.
Nach der eigenen Identität bzw. dem eigenen Selbst zu fragen ist eine Momentaufnahme, die Dich unter einer bestimmten Perspektive zu einem bestimmten Augenblick zeigt.
Deswegen ist die Frage aber nicht weniger wertvoll, hilfreich oder sinnvoll. Wichtig ist nur, die Identitätsproblematik in ihrem Umfang zu erfassen und die eigenen Vorannahmen zu reflektieren. » Hier geht's zum Test: Wer bin ich? - evtl. auch interessant für dich: Was ist Philosophie?
Quellen:
1) Albert Newen: Wer bin ich? In: Spektrum - Die Woche: 7. KW, 2011
2) Plutarch, Vita Thesei 23, Übersetzung von Wilhelm K. Essler, in: Was ist und zu welchem Ende betreibt man Metaphysik?, Dialectica 49 (1995), 281-315
3) Richard David Precht: Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise, Goldmann Verlag, 2007
4) R. Millière u. A. Newen: Selfless memories. In: Erkenntnis, 2022, DOI: 10.1007/s10670-022-00562-6
5) T. Fuchs: Selbsterleben und Selbststörungen. In: Selbst und Selbststörungen. Schriftenreihe der DGAP, Bd. 3, S. 31-65. Hrsg. v. Thomas Fuchs und Thiemo Breyer, Verlag Karl Alber, 2020