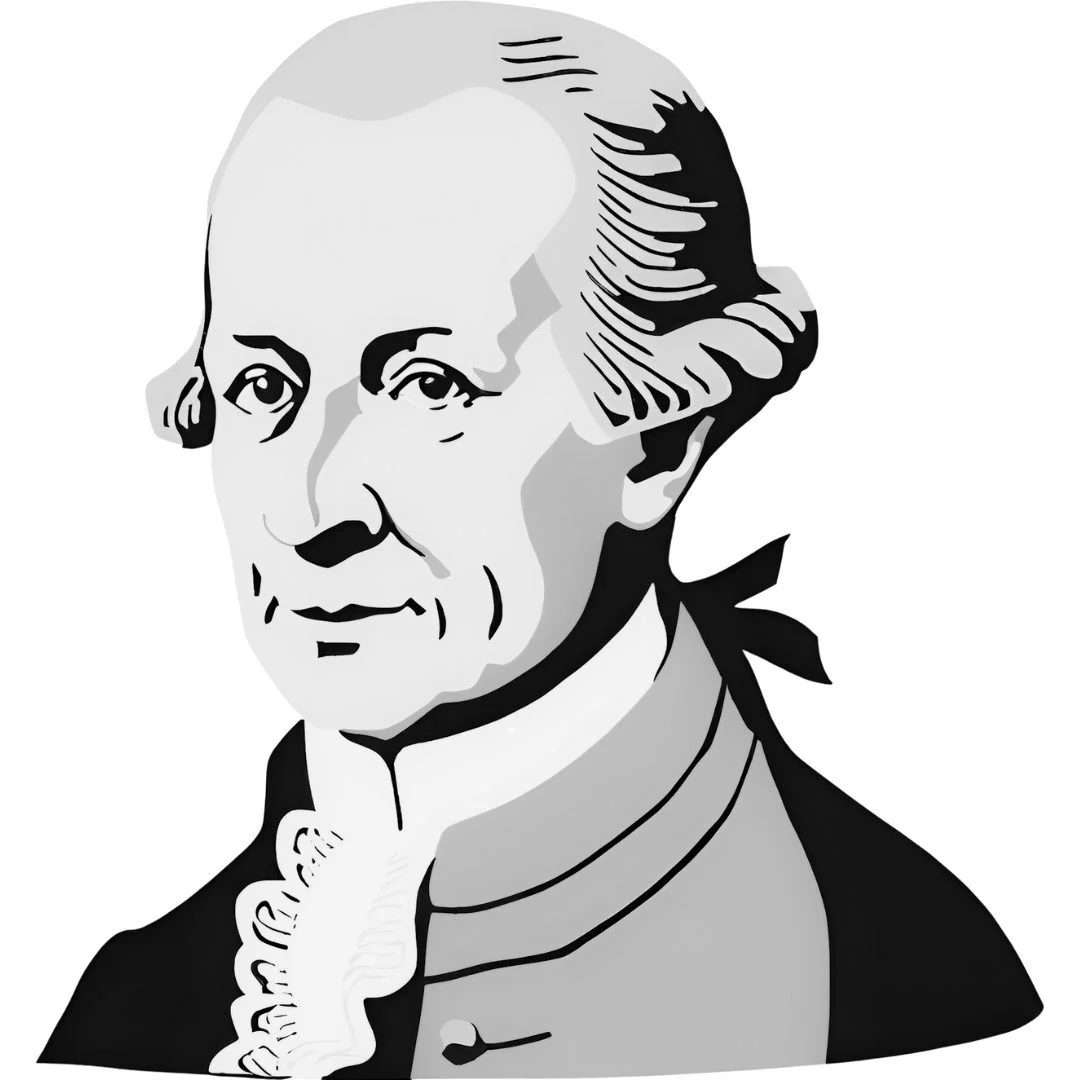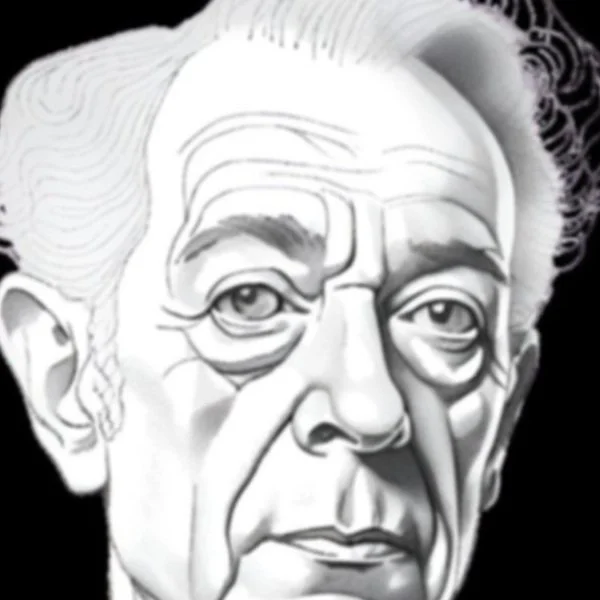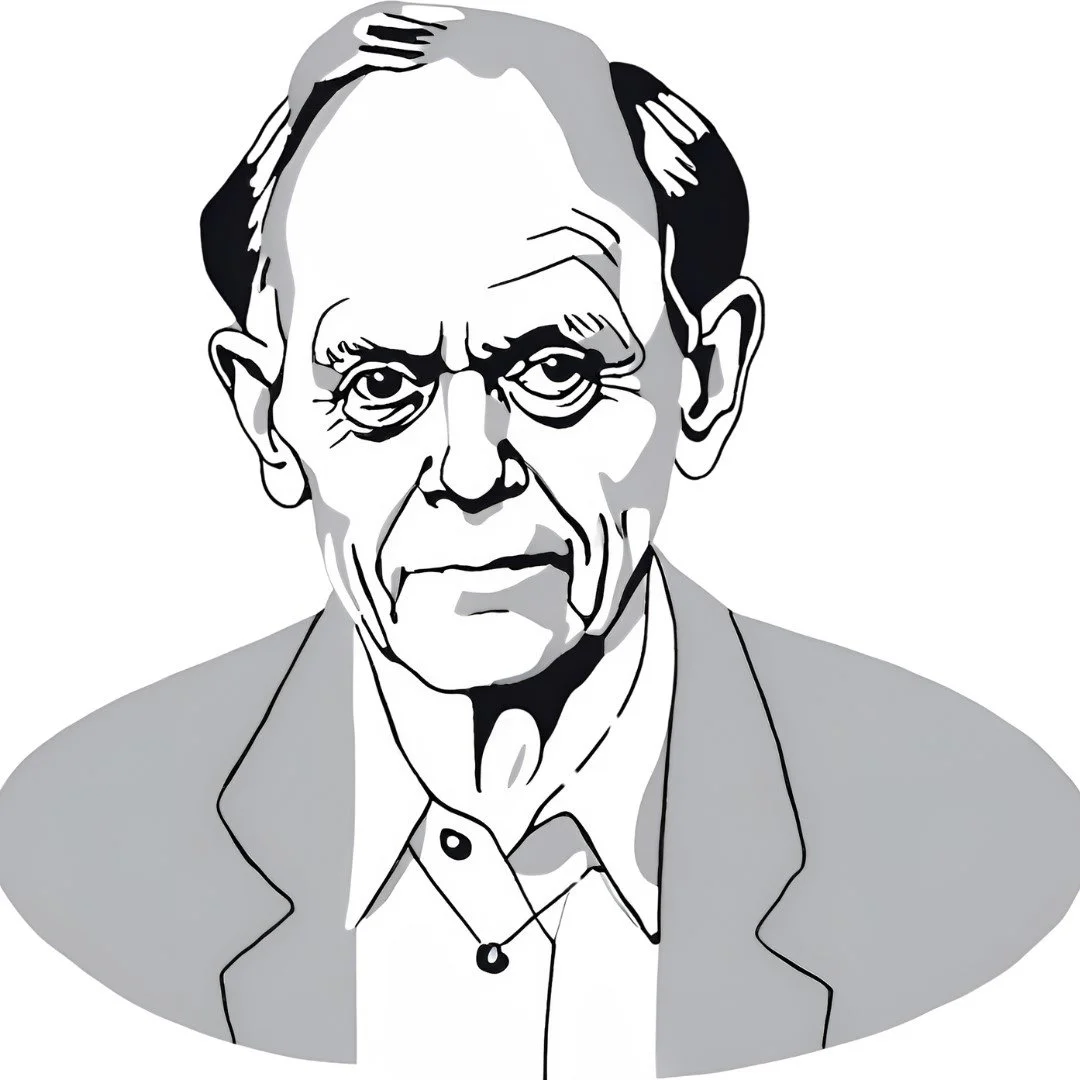Teil 1: Wahrheit in der Psychotherapie
Hier findest du den 2. Teil dieses Artikels:
Die therapeutische Unschärfe-Relation
Dieser Artikel basiert …
… auf einer früheren Veröffentlichung:
Mehrgardt, M., 2007: Die therapeutische Unschärferelation. In: Gegenfurtner, N. & Fresser-Kuby, R. (Hg.): Emotionen im Fokus. Bergisch Gladbach (Edition Humanistische Psychologie), 240-272.
Der zweite Teil dieses Artikels greift auszugsweise zurück auf meine Arbeit Erkenntnistheoretische Fundierung der Gestalttherapie, 1999. In: Fuhr, R., Sreckovic, M. & Gremmler-Fuhr, M. (Hg.): Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen (Hogrefe).
Einleitung: Plädoyer gegen therapeutische Schärfe
Dieser Artikel ist ein Plädoyer für eine therapeutische „Unschärfe“-Relation. Ich verwende diesen Terminus, um
mit Heisenberg ein Nicht-genau-Wissen zu bezeichnen statt des in der herrschenden Psychotherapie üblichen und wenig fundierten Paradigmas des Wissenden und um
mich gegen eine therapeutische Schärfe zu wenden, die sich im Sinne von Verletzung, Verantwortungs- und Schuldzuschreibung sowie Diskriminierung der Patientinnen[3] durch die Therapeuten in die Richtlinienpsychotherapie eingeschlichen zu haben scheint.
Aufbau und Ziele des Artikels
Dieses Plädoyer gründet auf fünf kritischen Thesen bezüglich des Auftretens und der Hintergründe einer solchen „scharfen“ Beziehungsgestaltung im Rahmen der gegenwärtigen Richtlinienpsychotherapie.
Anschließend werde ich meinen Dialektischen Konstruktivismus auszugsweise darstellen, eine erkenntnistheoretisch-ethische Grundlegung der (Gestalt-) Psychotherapie.
Mit diesem Artikel verfolge ich die Ziele,
einen kritischen Diskurs über die Konnotationen der gegenwärtigen Mainstream-Psychotherapie anzustoßen und
eine explizite Philosophie (wieder) als eine unverzichtbare Grundlage der akademischen (vorwiegend empirischen) Psychotherapie zu rehabilitieren.
Implizite Grundhaltungen der Mainstream-Psychotherapie
Die Wiedereinführung einer expliziten Philosophie, insbesondere der Disziplinen Erkenntnistheorie und Ethik, ist auch deshalb vonnöten, weil die gegenwärtige Mainstream-Psychotherapie sich ja nicht wirklich frei von (philosophischen) Ideologien gemacht hat, sondern zwangsläufig auf impliziten, d. h. verborgenen oder gar heimlichen und damit schädlichen Grundhaltungen und -aussagen fußt.
Zusammenspiel von Philosophie und empirischer Forschung
Auch wenn ich in dieser Arbeit deutliche Kritik an der gegenwärtigen empirischen Forschung erhebe, spreche ich mich nicht gegen Empirie aus; vielmehr ist meine Hoffnung, dass ein neuer Dialog zwischen philosophischen und empirischen Perspektiven entsteht mit dem Ergebnis, dass beide einander Korrektiv und auch Bereicherung sein mögen.
Und so zeigen ja der Greenberg’sche Forschungsansatz (Greenberg et al., 2003) und auch die Untersuchung Teschkes über existentielle Momente in der Therapie (1996) positive Wege einer Forschung auf, die nicht in einem angeblich wertfreien Niemandsland stattfindet und die nicht zwangsläufig einer mechanisch-kalten Empirie verpflichtet sein muss.
Eine weitere Bedeutung einer erkenntnistheoretisch-ethischen Grundlegung besteht speziell für die Gestalttherapie darin, ihre theoretischen Konstrukte widerspruchsfreier gestalten zu können. Auf diesen Aspekt gehe ich in dieser Arbeit nur am Rande ein.
These 1:
Die gegenwärtige Psychotherapie ist gekennzeichnet durch Schärfe.
Martin Buber:
„Dann kehrten die Namen in die Es-Sprache ein; immer stärker trieb es die Menschen, ihr ewiges Du als ein Es zu bedenken und zu bereden.“
M. Buber 1953, S. 5
(Bild mit Canva-KI generiert)
Ganz alltägliche Therapeuten-Äußerungen …
Ich werde im Folgenden Äußerungen von Psychotherapeuten zitieren, von denen mir berichtet wurde, die ich in Super- und Intervisionen sowie in therapeutischen Interaktionen direkt erlebt, in meinen Therapie-Aus- und Weiterbildungen selbst erfahren oder in Vorträgen und beim Literaturstudium rezipiert habe.
Es sind keine therapeutischen Interventionen, welche als unethisch auf den ersten Blick zu brandmarken wären, sondern es sind alltägliche, meist als hilfreich und wohlmeinend intendierte Äußerungen.
… auf dem maroden Fundament des Psychotherapie-Gebäudes
Es reicht hier nicht, sich mit einem Hinweis auf die dysfunktionale kognitive Verarbeitung oder auf Übertragung oder auf paranoide Projektion der Klientin aus der Verantwortung zu stehlen:
Vielmehr sind es, so behaupte ich, implizite Konnotationen eines maroden Psychotherapie-Gebäudes, welches seine Fundamente verloren hat.
Wichtig wäre es aber, sich des philosophischen Untergrundes wieder zu versichern, auf welchem Psychotherapie zwangsläufig stattfindet. Ich möchte eine Sensibilisierung dafür bewirken, dass sich therapeutische Grundhaltungen, auch wenn sie implizit bestehen, in den Empfängern unserer Botschaften manifestieren, und das nicht immer in positiver Weise.
Beispiele aus der Praxis
Hier folgen nun beispielhaft einige Therapeuten-Äußerungen aus verschiedenen Therapieschulen:
Du wolltest doch auf den heißen Stuhl! (Gestalt);
Sie haben eine Borderline-Störung, Sie sollten nicht mehr mit Menschen arbeiten! (an einen Erzieher mit anthroposophisch gefärbter Sprache, psychosomatische Klinik);
Du bist ja völlig gepanzert! (Körpertherapie);
Sie haben Panikattacken, weil Sie Angstsituationen vermeiden! (VT);
Ihr Kind symptomatisiert Ihre Konflikte (Familientherapie);
Ich spüre doch, dass du in Wirklichkeit aggressiv bist! (Tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie/ Gestalt);
Suchen Sie bei sich selbst! (zu einer Patientin, die erstmals Wut auf den Vater äußert, der sie sexuell missbraucht hat, Psychiatrie);
Das ist doch nur Ihre Projektion/ Übertragung! (Gestalt/ Psychoanalyse);
Sie werden Ihre Depressionen niemals los, wenn Sie bei Ihrer Frau bleiben! (Tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie);
Natürlich haben Sie sexuelle Probleme – sonst hätten Sie ja einen Mann! (Psychosomatische Klinik);
Liebesbeziehungen der Patienten untereinander sind verboten, weil sie Therapievermeidung sind! (Alkohol-Entwöhnungs-Klinik) usw.
Beispiele aus der Fachliteratur
Auch die Fachliteratur ist voll von scharfen Äußerungen über bestimmte Patientengruppen.
Über die narzisstische Persönlichkeit schreibt bspw. Marie-France Hirigoyen: Die Patientin ... hat eine großartige Meinung von ihrer eigenen Bedeutung ... beutet in zwischenmenschlichen Beziehungen den anderen aus ... es fehlt ihr an Empathie ... überhebliche Haltung ... (2003, 154).
Otto Kernberg belegt dasselbe Klientel mit Zuschreibungen wie: ... extrem egozentrische Einstellung und ein auffälliger Mangel an Einfühlung und Interesse für ihre Mitmenschen ... Fehlen echter Gefühle von Traurigkeit, Sehnsucht, Bedauern ... (1980, 263).
By the way …
Meines Erachtens stößt man auf Menschen mit ausgeprägter narzisstischer Störung eher bei Vorgesetzten oder in der Politik. Solche Personen begeben sich aber höchst selten in eine Psychotherapie, weil sie selbst nämlich an ihrer Störung am wenigsten leiden.
Sicherlich liegt die Schärfe solcher Äußerungen nicht allein und auch nicht in erster Linie in ihrer Wortwahl begründet; sie zeigt sich als solche dem Gegenüber wohl immer dann, wenn sie Ausdruck einer Grundhaltung und Be-Deutung des anderen ist.
Fänden Sie, liebe Leserinnen, solche an Sie gerichteten Bemerkungen hilfreich? Würden Sie diese nicht als gegen die eigene Person gerichtet empfinden statt als Hilfestellung?
Muss nicht der Verdacht aufkommen, diese seien Ausdruck von Frustration, Hilflosigkeit, Unsicherheit des Therapeuten oder, wie Peter Fiedler formuliert: ... ‚Erklärungshilfe‘ für schwierige Therapieentwicklungen ... (2004, S. 8).
Verletzende Schärfen in Therapeuten-Äußerungen
Wenn ich von Schärfe der therapeutischen Relation spreche, meine ich dies in zweierlei Hinsicht:
Scharfe Interventionen verletzen, sprechen schuldig, werten ab, machen abhängig und ohnmächtig.
Du hast etwas falsch gemacht, und deshalb bist du krank geworden!, sagen sie dem Patienten. Wenn sich schließlich Probleme im Therapieverlauf zeigen, werden die Patientinnen von manchen …
... Therapeuten zunehmend als nicht einsichtig, widerständig bis feindselig beschrieben.
So zitiert Fiedler den Psychoanalytiker Lothstein in dem genannten Artikel (2004, 10).
Scharfe Interventionen sind trennend und diskriminierend.
Sie stellen einen Unterschied zwischen Therapeutin und Klient her. Die implizite Botschaft lautet etwa:
Du bist anders, verrückt. Du gehörst nicht zu uns, bist ausgeschlossen. Ich bin unerreichbar für dich! Solche Botschaften enthalten menschliche Begegnung vor; sie sind Ent-Gegnungen. Damit ist aber eine Grunddimension des Leidens angesprochen, die meines Erachtens in jedem physischen wie psychischen Leid aufscheint: die Angst vor oder das Erleben von sozialer Ausgrenzung (vgl. Mehrgardt 2001).
Wenn man sich solcher Schärfen und der damit verbundenen Verletzungen der Patientinnen bewusst wird, wenn man diese, und dazu neige ich, nicht nur als einzelne „Ausrutscher“, sondern als umfassende Manifestationen einer unbegründeten Psychotherapie-Kultur versteht, dann stellt sich angesichts der empirisch belegten Erfolge der Psychotherapie doch die Frage:
Funktioniert Psychotherapie vielleicht nicht wegen, sondern trotz der Psychotherapeuten?
These 2:
Die gegenwärtige Psychotherapie betet zu einem Götzen namens Akademische Empirie
Martin Heidegger:
„Das Denken in Kausalitätsreihen (wenn ... – dann ...) zeigt das ‚machenschaftliche Wesen‘ der Wissenschaft. Es ist ein Irrtum, mit dieser Methode je das Lebendige fassen zu können.“
M. Heidegger, 1989, 147 ff.
(Bild mit Canva-KI generiert)
Immanuel Kant und die Empirie
In seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten warnt Immanuel Kant davor, Gesetze der Sittlichkeit – und ich hoffe doch sehr, dass Psychotherapie und Sittlichkeit etwas miteinander zu tun haben! – allein empirischen Beispielen zu entlehnen:
Immanuel Kant:
Denn jedes Beispiel ... muss selbst zuvor nach Principien der Moralität beurtheilt werden ... (1968, S 408).
[Empirie ohne eine] ... reine von allem Empirischen abgesonderte Vernunfterkenntniß ... [bringt] ...einen ekelhaften Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen und halbvernünftelnden Principien zum Vorschein, daran sich schale Köpfe laben, weil es doch etwas gar Brauchbares fürs alltägliche Geschwätz ist, wo Einsehende aber Verwirrung fühlen ... (ebd., 409).(Bild mit Canva-KI generiert)
Mit diesem Zitat trete ich nicht gegen das Fortbestehen einer akademischen Empirie an. Ich halte es aber für dringend geboten, ihrer Selbstverliebtheit Einhalt zu gebieten, ihr Kontrapunkte entgegenzustellen und ihren Heiligenschein zu demontieren.
Empirische Forschung darf also nicht als Ganze verdammt werden!
Vielmehr geht es darum, die positive Chance, welche die Gestalt-Forschung bietet- und so auch die Greenbergs – zu ergreifen, ohne sie, wie es ihre elfenbeinerne Mainstream-Schwester offenbar erträumt, von allem Wesentlichen, Existenziellen und Philosophischen zu „befreien“.
Eine kleine Episode
Dazu folgendes Erlebnis: Als ich einmal ich einem ICD-10-Übungsseminar am Ende bemängelte, ein solches System wie das ICD-10 (psychotherapeutisches Diagnostik-Schema) sei zwar praktikabel, aber ihm fehle ein philosophischer Unterbau, der die Möglichkeit bereitstelle, seine unkontrollierte Ontologisierung (= Thesen werden heimlich zu Fakten) zu entdecken und nötigenfalls seine Selbstaufhebung zu bewirken, ereiferte sich einer der Urheber dieses Werkes sinngemäß:
Ich musste als Student noch Martin Heidegger hören und bin froh, dass die heutige Medizin von derartigem metaphysischen Ballast befreit ist. Da halte ich mich doch lieber - und während er dies sagte, ließ er seine Linke sanft auf die blaue ICD-10-Ausgabe sinken - an diese unsere Bibel.
Dann, als er merkte, was er gesagt hatte, stockte er, sah mich an und lächelte. – In dem Moment haben wir uns verstanden.
Wissenschaftstheorie
Methodenimmanente Grundlagenprobleme der Statistik – Probleme der Skalenniveaus, der Gegenläufigkeit verschiedener Validitäten – will ich gar nicht ins Feld führen; ich billige jeder Herangehensweise ihre Unstimmigkeiten zu.
Anmerken möchte ich aber, dass sich der „Geist“ des Kritischen Rationalismus Karl R. Poppers und Hans Alberts (1968), auf dessen erkenntnis- und wissenschaftstheoretisches Fundament sich akademische Empirie beruft, ins Gegenteil verkehrt zu haben scheint: von der ursprünglichen Falsifikationslogik* hin zu einem mechanisch klappernden Verifizierungsbetrieb: Bestätigungen der Nullhypothese werden offensichtlich kaum publiziert!
* Eine zentrale These Poppers ist, dass empirische Befunde nicht als wahr verallgemeinert werden können. Deshalb müsse man versuchen, das Gegenteil der aus den empirischen Befunden abgeleiteten These als falsch zu beweisen (dh die Nullhypothese zu falsifizieren).
Karl R. Poppers Intention war eine ganz andere gewesen (deren Scheitern er allerdings vorausgesehen hat):
Karl R. Popper:
“Wir wissen nichts – das ist das Erste. Deshalb sollten wir sehr bescheiden sein – das ist das Zweite. Daß wir nicht behaupten zu wissen, wenn wir nicht wissen – das ist das Dritte. Das ist so ungefähr die Einstellung, die ich gerne popularisieren möchte. Es besteht wenig Aussicht dafür.”
K. Popper, 1999, S. 144 (Bild mit Canva-KI generiert)
Was benötigt die heutige Psychotherapie zu ihrer Heilung?
Popper hat Recht, und so sieht sich dann auch Heiner Keupp genötigt, über die heutige Psychotherapie zu schreiben:
... auf der anderen Seite erfolgt eine Verbetriebswirtschaftlichung in Form von Modularisierung und Manualisierung. Diskurse über den gesellschaftlichen Stellenwert von Psychotherapie und ihre Menschenbilder sind fast verstummt. (2003, 4)
Überlassen wir die Psychotherapie allein diesem universitären Karrierespiel, werden wir sie an eine Disziplin verlieren, die sich nur noch Psychotechnik nennen dürfte.
Was also fehlt unserer modernen, unserer erstarrenden Richtlinien-Psychotherapie?
Es fehlt ihr zum einen das Korrektiv durch die vielen erfahrenen Praktikerinnen „da draußen“, die in der Lage sind, die Lebenskontexte ihrer Klienten zu erfassen, die über einen riesigen Fundus an Berufs- und Lebenserfahrung verfügen. Deren Empirie gilt es gegenüber der akademischen zu rehabilitieren.
Zum zweiten fehlt der Psychotherapie eine philosophische und anthropologische Fundierung. Ohne einen solchen Untergrund wuchert Theorienbildung, nur auf Statistiken beruhend, nahezu beliebig. Beide – Empirie und Philosophie – sollten stattdessen einander Korrektiv und Ansporn sein.
Ich trete dafür ein, dass wir uns von dichotomen oder dualen (= scharfen) Unterscheidungen abwenden und uns dialektischen, „unscharfen“ Begriffsbildungen annähern. Dichotome Ansätze fußen auf diskreten „Wahr/ falsch“-Unterscheidungen und zielen darauf ab, Fehler auszumerzen; dialektische hingegen verstehen Wahrheit als relationalen (nicht: relativistischen!) Prozess und sehen als Kriterium der Wahrheit ihre Veränderlichkeit an. Ein „Fehler“ ist in dieser Sichtweise eine an einen persönlichen Standpunkt gebundene Bewertung und kein In-Abrede-Stellen von Wahrheit.
These 3:
Das vorherrschende Wissens- und Behandlungsparadigma der Psychotherapie fußt auf Verifikations-Zirkularitäten
Erich Fried:
„Zweifle nicht/ an dem/ der dir sagt/ er hat Angst//
aber hab Angst/ vor dem/ der dir sagt/ er kennt keinen Zweifel!“
Erich Fried 1974 (Bild mit Canva-KI generiert)
Zweifel als heuristisches Instrument
Ich weiß nicht, ob andere Kolleginnen ebenso wie ich an der eigenen Arbeit zweifeln; geäußert wird Zweifel jedenfalls viel zu selten.
Vielmehr scheint zu gelten: Je komplexer der wissenschaftliche Gegenstand, desto dogmatischer die Aussagen der Fachleute.
Patientin X hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Äußerungen wie diese treten heutzutage als Feststellung und Faktum auf, nicht mehr als Hypothese, Konstrukt oder Frage. G wie gesichert lautet das Diagnosen-Suffix, mit welchem diese – in Abgrenzung von V wie Verdacht – neuerdings zu versehen ist.
Die früher typische – und heuristisch wertvolle! – zweifelnde Psychologenhaltung (Es könnte so sein oder auch so oder vielleicht doch nicht ...?) hat der Gleichmachung durch den schulmedizinischen naiven Realismus (Es ist so und nicht anders!) nicht standhalten können.
Dabei ist diese öffentlich akzeptierte Art des „Wissens“ hohles, luftleeres Geschwätz, welches nur durch Standesautorität zur Geltung kommt. Durch einfachste Mittel ist dieses selbstherrliche Gebäude der Psychomechanik zum Einsturz zu bringen, nämlich durch mehrmaliges Fragen:
Woher weiß ich das? Woher weißt du das? Wieso können Sie sich so sicher sein?
Probieren Sie es aus, indem Sie eine beliebige Aussage über einen Ihrer Patienten treffen, z. B.:
Die Angst von Patientin X wird aufrechterhalten, weil sie Situation a meidet.
Woher weiß ich das?
Das besagt die Lerntheorie.
Woher weiß ich, dass diese Lerntheorie in diesem Fall anwendbar ist?
Weil die Angst ja schon gelöscht wäre, wenn die Patientin nicht vermieden hätte.
Sie sehen: Es handelt sich hier um eine zirkuläre Begründung. Andere typische „letzte“ Antworten lauten etwa:
Das hab‘ ich gelesen.
Das weiß doch jeder.
Das ist eben so.
Die Intervention X hat laut Studie Y eine Effektivität von z %.
Ich habe gegen Zirkularitäten nichts Grundsätzliches einzuwenden; denn letzten Endes können wir diesem erkenntnistheoretischen Zirkel nicht entrinnen.
Aber wenn wir zirkuläre Aussagen mit einem Ausrufungszeichen versehen (Sie dürfen a nicht mehr vermeiden!) statt mit einem Fragezeichen (Wird es uns weiterhelfen, wenn Sie Situation a nicht mehr vermeiden?), laufen wir Gefahr, hypothesenwidrige Anzeichen nicht ernst zu nehmen und – theoriengerecht! – mit der Intervention fortzufahren.
Immunisierung der Psychotherapie gegen ihr Scheitern
Nehmen wir einmal an: Wir haben mit allen Mitteln (Intervisionen, Eigenanalysen, therapeutischen Beziehungsklärungen, theoretischen Erörterungen, Aufspüren verdeckter operants ...) versucht, das Scheitern einer Therapie abzuwenden, aber vergebens.
Nun setzt die allen dogmatischen Gebilden inhärente Verifikations-Zirkularität ein. Dazu existieren in allen Anwendungen „Notfallkonstrukte“, die das Scheitern theorien- und therapeutenschonend „erklären“ und der Patientin (hier ist der Begriff der „Erleidenden“ leider zutreffend!) in die Schuhe schieben.
Solche Falsifikations-Blocker sind Konstrukte wie:
Motivation: Der Patient will gar nicht richtig. Die Patientin muss erstmal so richtig auf die Schnauze fallen!
Einsichtsfähigkeit: Der Patientin fehlt es an intellektueller Reife. Sie hat dort einen blinden Fleck!
Widerstand: Der Patient hält an der kranken Beziehung zu seiner Mutter fest und will sich nicht von ihr lösen!
Vermeidung: Klar! Wenn sie sich der Angst nicht stellt, kann sie auch nicht gelöscht werden!
Krankheitsgewinn: Der Patient will berentet werden und wehrt sich deshalb gegen seine Gesundung!
Körperpanzer: Dein Körper ist ja total gepanzert, deshalb hast du diese emotionalen Blockaden!
Kontaktunterbrechung: Die Patientin verhindert durch ihre Konfluenz den Kontakt zu ihrer eigentlichen Aggression.
Thanatos: Dass sie immer wieder zu ihrem prügelnden Ehemann zurückkehrt, ist Ausdruck ihres unbewussten Todestriebes.
Der Psychotherapeut als Hure
Betrachtet man derartige Konstrukte durch eine erkenntnistheoretische Brille, stellt man sogleich fest, dass diese keinesfalls individuelle Vorgänge beschreiben können; vielmehr implizieren sie immer schon ein Gegenüber, also hier: die Therapeutin, die ja unausweichlich eigene Interessen verfolgt, zB sich nicht mit dem eigenen Scheitern auseinandersetzen zu müssen.
Solche Konstrukte beschreiben also nicht einen von seinem Kontext losgelösten Patienten, sondern sie sind Beschreibungen von Dyaden, und zwar notgedrungen aus der Sicht des Psychotherapeuten mit seinen ihm eigenen Motiven.
Einer solchen Interpretation werden jedoch weitere Konstrukte in den Weg gestellt: So bilden etwa Übertragung und Abstinenz Verteidigungswälle gegen die menschliche Einbeziehung des Therapeuten in das emotionale Geschehen mit der Patientin, vergleichbar der ehernen Prostituiertenregel, den Freier nicht auf den Mund zu küssen, um sich ja nicht in diesen zu verlieben.
Mit diesen Tricks wird der Therapeut aber vollends zur Hure, indem er die Patientin zur emotionalen Befriedigung lockt, sich der menschlichen Begegnung dann aber verweigert.[4]
Jede Schule verfügt über ihr eigenes Repertoire zur Selbst-Bestätigung und Rettung ihrer Reputation. Zu diesem Zweck bedient man sich auch gern einmal im „feindlichen Lager“.
Peter Fiedler fügt diesem Arsenal noch eine weitere Abwehrwaffe gegen Infragestellung hinzu, nämlich das nachträgliche Diagnostizieren einer Persönlichkeitsstörung als „Erklärungshilfe“ (2004, 8).
Hätte der Psychotherapeut jedoch in solchen Situationen den Mut zum Zweifel und könnte er auf derartige Vernichtungsstrategien verzichten, so würden sicherlich in ihm andere, hilfreichere Motive auftauchen, nämlich
... Neugier als heuristisches, Behutsamkeit als pragmatisches und Staunen als ästhetisches Leitmotiv. (Mehrgardt/ Mehrgardt 2001, S. 201).
Oder wie es zugleich banal und unvergesslich ein Drogentherapeut auf einem Kongress über Substitution ausdrückte:
Warum fragen wir nicht einfach die Junkies?!
These 4:
Die Psychotherapie leidet an einem zentralen Skotom für gesellschaftliche Missstände.
Paul Feyerabend
„Nicht rationalistische Maßstäbe, nicht religiöse Überzeugungen, nicht humane Regungen, sondern Bürgerinitiativen sind das Filter, das brauchbare von unbrauchbaren Ideen und Maßnahmen trennt.“
P. Feyerabend 1980, S. 77 (Bild mit Canva-KI generiert)
Reduktion auf schulen-kompatibles Material
Die Falsifikations-Blocker der Psychotherapien und die damit verbundene implizite Attribuierung der Schuld an Symptomgenese und Therapieversagen auf die Klientin verführt den Therapeuten allzu leicht dazu, das phänomenale Erleben der Klientin nur so weit zu würdigen, wie es Material für die Anwendung der eigenen Theorie liefert:
Negative Kognitionen etwa oder psychodynamische Konflikte dürfen und sollen mitgeteilt werden und erfahren entsprechende therapeutische Anerkennung. Schweift der Klient jedoch ab, wird er mit sanftem Nachdruck zu Thema und Schema zurückgeführt.
Klagen über äußere Stressoren
Was aber Therapeutinnen selten als solches ernst zu nehmen scheinen, sind Klagen über äußere Belastungen. Diese Äußerungen werden als Beispiele fehlerhafter emotional-kognitiver Verarbeitung oder widerständiger Projektion aufgegriffen und therapeutisch verwertet. Kommen die Patienten jedoch von derartigen Schilderungen nicht recht los, laufen sie Gefahr, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden:
Suchen Sie bei sich!
Was mag das wohl mit Ihnen zu tun haben?!
Können Sie sich vorstellen, welchen Anteil Sie selbst daran haben?“
Solche Therapeutenaussagen transportieren Desinteresse am Erleben de Patientin und an den Lasten, die sie zu tragen hat.
Nicht alle äußeren Belastungen lassen sich aber durch „funktionale Verarbeitung“ oder „Auflösung von Übertragungen“ einfach wegzaubern!
Beispiel: Burnout bei Lehrern
Sehr deutlich wird diese Tendenz in der Literatur über Stress und Burnout bei Lehrern.
Wenn überhaupt, werden schädliche äußere Faktoren zwar benannt; aber letztlich wird der einzelnen Lehrerin Schuld an der Entstehung und alleinige Verantwortung für die Beseitigung der Symptome zumindest implizit zugeschrieben, indem bspw. von Überengagement, Perfektionismus oder fehlender Stressbewältigungskompetenz die Rede ist (vgl. bspw. Gebauer 2000, Hagemann 2003).
Mehr zum Thema Schule und Lehrerinnen finden Sie hier:
https://www.die-inkognito-philosophin.de/mehrgardt-exkursionen
Psychotherapie als Magd der Gesellschaft
Psychotherapie ist zum gesellschaftlichen Bewahrer geworden, zum Aufpasser und Anpasser. Statt auf Hippokrates und Sokrates müsste sie sich heute auf Prokrustes berufen, indem sie ihre Patientinnen auf den ihnen zugewiesenen Platz zurechtstutzt. Ist Psychotherapie nicht inzwischen tatsächlich jene Geständniswissenschaft geworden, die Michel Foucault (1998) beschwört?! Muss ihr nicht jene Gesellschaftsvergessenheit angekreidet werden, die Keupp beklagt (2003, 4)?
Wo sind emanzipatorische, revolutionäre Ansätze geblieben?
Wo werden Symptome noch als Protuberanzen an der Oberfläche (da wo die Kruste dünn ist) einer tief in der Gesellschaft stattfindenden Verwesung von Mitmenschlichkeit verstanden?
Wo werden Patienten zur Ver-rückung erstarrter gesellschaftlicher Prinzipien ermutigt?
Wo gibt es therapeutisch-politische Perspektiven auf das individuelle Symptom als Widerspiegelung gesellschaftlicher Aporien? Was ist mit emanzipatorischen Therapieansätzen wie der Gestalttherapie? Wer hat ihr den anarchistischen Zahn gezogen? So schrieb der Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter:
Unter den therapeutischen Erfolgskriterien taucht der Begriff emanzipatorisch nicht mehr auf. (2004, S. 277)
Warum erheben die Psychotherapeutinnen nicht ihre Stimme gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen?
Warum verbreiten sie stattdessen „Küchenpsychologie“ wie: „Psychologen haben herausgefunden, dass verheiratete Männer einen niedrigeren IQ haben als Singles“?
Psychotherapie sollte randständig sein, um einen Blick auf den gesellschaftlichen Kontext individuellen Leids werfen zu können. In der Gestalttheorie heißt es, dass der (gesellschaftliche) Hintergrund die Figur (der individuellen Prozesse) be-deutet, d.h. mit Deutung versieht.
Aus einer marginalen Perspektive, losgelöst von herrschenden Doxa im Sinne Bourdieus (1979), könnten wir dann vielleicht auch einiger Para-Doxa ansichtig werden, auf denen unser Sozialwesen zu ruhen scheint, z. B. des folgenden: Es ist neurotisch, in einer neurotischen Gesellschaft nicht neurotisch zu sein (vgl. Mehrgardt 2001).
Khalil Gibran ist da viel weiser als wir Psychotherapeuten, wenn er den König seines durch den Genuss vergifteten Wassers verrückt gewordenen Volkes nunmehr auch aus dem kontaminierten Brunnen trinken lässt (1984, 20 f.).
These 5:
Erkennen ist der Königsweg zur Heilung. – Aber niemand weiß, was Erkennen eigentlich ist!
Martin Buber
„Was weiß man also vom Du? –
Nur alles. Denn man weiß von ihm nichts Einzelnes mehr.“
M. Buber 1962, S. 15 (Bild mit Canva-KI generiert)
Erkennen ist das Werkzeug der Psychotherapeutin
Als Psychotherapeutinnen erkennen wir immerzu,
indem wir Diagnosen erstellen, indem wir den nächsten Behandlungsschritt planen, indem wir den Therapie-Prozess evaluieren.
Wir erkennen Ursachen, Zusammenhänge und Folgen, Übertragungen (und möglichst auch Gegenübertragungen!), Abwehrmechanismen, Körperpanzer, Kontaktunterbrechungen, Inkongruenzen, emotionale Blockaden, unbewusste Konflikte, Sinn, Wege, Ziele ...
Sobald der Klient zum Erstgespräch den Raum betritt, erkennen wir, dass er Psychotherapie benötigt oder jedenfalls benötigen würde, wenn er sie nur annehmen könnte.
Und lange Zeit vorher haben wir erkannt, dass Psychotherapie eine Lösung ist und nicht etwa das Problem.
Auch haben wir schon früh erkannt, welche Therapie-Richtung die beste Lösung ist.
Natürlich gibt es für alle diese Erkenntnisse gute Argumente. Aber auch Argumente müssen für genau diese Erkenntnis als Argumente erkannt werden.
Was aber ist Erkenntnis?
Wie kommt sie zustande? Wodurch wird sie gültig oder wichtig oder wahr oder verantwortbar? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die philosophische Disziplin der Erkenntnistheorie.
In der Mainstream-Psychotherapie jedoch gibt es keine Erkenntnistheorie!
Es gibt gerade noch Wissenschaftstheorie, die aber erstens an die akademischen Institute verwiesen worden ist und die zweitens jeden Bezug zur philosophischen Basis verloren hat. Dazu Jürgen Habermas:
Jürgen Habermas:
Wo ... ein Begriff des Erkennens, der die geltende Wissenschaft transzendiert, überhaupt fehlt, resigniert Erkenntniskritik zur Wissenschaftstheorie; diese beschränkt sich auf die pseudonormative Regelung der etablierten Forschung. […]
Eine solche Wissenschaftstheorie ist nur noch eine [...] vom philosophischen Gedanken verlassene Methodologie ... .
J. Habermas, 1988, S. 12 f. (Bild mit Canva-KI generiert)
Patientinnen weisen uns den Weg zur Erkenntnistheorie
Die Ablehnung findet sich oft unter der Oberfläche.
Ich vermute, dass die meisten Patienten sich nach Empfang entgegnender Botschaften unbehaglich, vielleicht abgewertet fühlen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kolleginnen meistens das, was sie sagen, wohlwollend und unterstützend meinen.
Und weiterhin glaube ich, dass es gerade wegen dieser akzeptierenden Beziehungsoberfläche äußerst schwierig ist, diese grundlegendere Ablehnung zu fassen zu kriegen, weshalb sie in der Regel nicht aufgearbeitet wird, sondern eher zu „Widerstand“, Misserfolg oder Abbruch führt.
Borderliner weisen uns die Grenzen der Erkenntnis auf.
Es scheint übrigens zumindest eine Gruppe von Patientinnen zu geben, die uns mit diesen Grundhaltungen und den daraus resultierenden Widersprüchen konfrontiert und scheitern lässt: die sogenannten Borderliner.
Anders als in einem Großteil der Fachliteratur dargestellt, nehme ich bei diesen Menschen weniger deren Beziehungsunfähigkeiten, Spaltungstendenzen und Schwarz-weiß-Malereien wahr als vielmehr eine verstörende Sensibilität für implizite und widersprüchliche Botschaften, auf welche sie uns gnadenlos zurückwerfen.
Unsere selbst-verständlichen und fraglosen, i. e. pragmatischen und positivistischen Erkenntnistheorien (und Ethiken und Anthropologien und Krankheitsmodelle ...) funktionieren da nicht mehr!
Und so halte ich es für nicht verwunderlich, dass uns diese Patientinnen als erste zu einer erkenntnistheoretischen Diskussion gezwungen haben, in deren Gefolge eine dialektische Grundlegung aufzutauchen scheint (vgl. Marsha Linehan’s Dialektisch Behaviorale Therapie; 1996).
In anderen Wissenschaften entstehen ebenfalls Ansätze der dialektischen Unschärfe oder auch Fehlerfreundlichkeit“, z. B. in der Philosophie (vgl. dazu Walther Zimmerli 1989), in der Informationstechnologie (fuzzy-Logik) und in der Technik (Einsatz von absturzorientierten Computer-Programmen in Maschinen; vgl. „der Spiegel“ 16/ 2004, S. 148).
Auch mein eigener Standpunkt ist ein dialektischer, den ich im nächsten Artikel kurz darstellen möchte: mein Dialektischer Konstruktivismus
-
Albert, H. (1968): Traktat über kritische Vernunft. Tübingen: Mohr.
Bateson, G. (19835): Ökologie des Geistes. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Bateson, G. (1987): Geist und Natur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Bischof, N. (1966): Erkenntnistheoretische Grundlagenprobleme der Wahrnehmungspsychologie. In: Metzger, W. / Erke, H. (Hg.) (1966).
Bourdieu, P. (1979): Entwurf einer Theorie der Praxis. Frankfurt a. M.
Buber, M. (1953): Einsichten. Wiesbaden: Insel.
Buber, M. (1962): Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Lambert Schneider.
Buber, M. (1962 a): Reden über Erziehung. In: Martin Buber. Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie. München: Kösel/ Lambert Schneider.
Dell, P. (19902): Klinische Erkenntnis. Zu den Grundlagen systemischer Therapie. Dortmund: Modernes Lernen.
Eidenschink, K. (1995): Ein Versuch mit der Wahrheit. Gestalttherapeutische Überlegungen mit Nietzsche. Gestalttherapie 2, 36-50.
Feyerabend, P. (1980): Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Fiedler, P. (2004): Ressourcenorientierte Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen. In: Psychotherapeutenjournal 1, 4–12.
Foerster, H. v. (1990): Das Konstruieren einer Wirklichkeit. In: Watzlawick, P. (1990).
Foucault, M. (1998): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit. Erster Band. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Frambach, L. (1995): Gestalttherapie und Spiritualität. Transpersonale Psychologie und Psychotherapie 2, 22-39.
Frambach, L. (1996): Salomo Friedlaender/ Mynona. Gestalttherapie 1, 5-25.
Fried, E. (1974): Das Gedicht „Angst und Zweifel“ ist enthalten in: Gegengift. S. 20. Berlin: Wagenbach.
Fuhr, R. / Portele, H. (1990): 'Kontakt' und 'Kontaktunterbrechungen' - ein erkenntnistheoretischer Irrtum? Gestalttherapie 2, 54-59.
Fuhr, R. / Sreckovic, M. / Gremmler-Fuhr, M. (1999): Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen: Hogrefe.
Gebauer, K. (2000): Stress bei Lehrern. Stuttgart: Klett-Cotta.
Gibran, K. (1984): Der weise König. In: Der Narr. Lebensweisheit in Parabeln, Olten/ Freiburg im Breisgau: Walter.
Grawe, K. (1988): Heuristische Psychotherapie. Eine schematheoretisch fundierte Konzeption des Psychotherapieprozesses. Integrative Psychotherapie 4, 309-324.
Grawe, K. (1988 a): Der Weg entsteht beim Gehen. Ein heuristisches Verständnis von Psychotherapie. Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis 1, 39-49.
Greenberg, L. / Rice, L. / Elliott, R. (2003): Emotionale Veränderung fördern. Paderborn: Junfermann.
Habermas, J. (1988): Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hagemann, W. (2003): Burn-out bei Lehrern. München: Beck.
Haken, H. / Stadler, M. (Hg.) (1990): Synergetics of Cognition. Berlin: Springer.
Hegel, G. (1975 a): Wissenschaft der Logik I. Hrsg. v. G. Lasson. Hamburg: Meiner.
Hegel, G. (1975): Wissenschaft der Logik II, Hrsg. v. G. Lasson. Hamburg: Meiner.
Heidegger, M. (198616): Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer.
Heidegger, M. (1989): Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Abschnitt 76: Sätze über „die Wissenschaft“. In: Martin Heidegger. Gesamtausgabe, Band 65. Frankfurt a. M.: Klostermann.
Held, K. (1985): Edmund Husserl. In: Höffe, O. (1985).
Hirigoyen, M.-F. (2003): Die Masken der Niedertracht. München: dtv.
Höffe, O. (Hg.) (19852): Klassiker der Philosophie. Von den Vorsokratikern bis David Hume. Bd.1. München: Beck.
Höffe, O. (Hg.) (19852): Klassiker der Philosophie. Von Immanuel Kant bis Jean-Paul Sartre. Bd.2. München: Beck.
Hoffman, L. (1991): Das Konstruieren von Realitäten: eine Kunst der Optik. Familiendynamik 16, 207-225.
Jaspers, K. (1948 a): Allgemeine Psychopathologie. Berlin/ Heidelberg: Springer.
Jaspers, K. (1948 b): Der philosophische Glaube. München: Piper.
Kant, I. (1958): Schriften zur Metaphysik und Logik. In: Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, Bd.III, hrsg. v. W. Weischedel. Wiesbaden: Insel.
Kant, I. (1968): Kants Werke. Akademie Textausgabe. Bd. IV. Berlin: Walter de Gruyter.
Keiler, P. (1980): Isomorphie-Konzept und Wertheimer-Problem. Beiträge zu einer historisch-methodologischen Analyse des Köhlerschen Gestaltansatzes. Gestalt Theory 2, 78-112.
Keller, A. (1982): Allgemeine Erkenntnistheorie. Stuttgart: Kohlhammer.
Kernberg, O. F. (1980): Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Keupp, H. (2003): Wieviel Flexibilisierung verträgt der Mensch? In: Gestalttherapie 2, 3–21.
Krohn, W. und Küppers, G. (1990): Selbstreferenz und Planung. In: Niedersen, U. (Hg.) (1990).
Krüll, M. (1987): Systemisches Denken und Ethik. Politische Implikationen der systemischen Perspektive. Zeitschrift für systemische Therapie 5, 250-255.
Linehan, M. (1996): Dialektisch-Behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. München: CIP-Medien.
Ludewig, K. (1987): Vom Stellenwert diagnostischer Maßnahmen im systemischen Verständnis von Therapie. In: Schiepek, G. (Hg.) (1987).
Maturana, H. (1990): Kognition. In: S. Schmidt (Hg.), 1990.
Maturana, H. / Varela, F. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern: Scherz.
Mehrgardt, M. (1994): Erkenntnistheoretische Grundlegung der Gestalttherapie. Münster/ Hamburg: LIT.
Mehrgardt, M. (1996): Erkenntnistheorie und Gestalttherapie. Teil 2: Modelle und Maximen gestalttherapeutischen Handelns. Gestalttherapie 2, 25-41.
Mehrgardt, M. (1997): Erkenntnistheorie und Gestalttherapie. Teil 3: Erkenntniskritik gestalttherapeutischer Konzepte. Gestalttherapie 1, 26-42.
Mehrgardt, M. (1999): Erkenntnistheoretische Fundierung der Gestalttherapie. In: Fuhr, R. et al. (1999), 485–511.
Mehrgardt, M. (2001): Homo Solus. In: Gestalttherapie 1, 3–25.
Mehrgardt, M. / Mehrgardt, E.-M. (2001): Selbst und Selbstlosigkeit. Köln: Edition Humanistische Psychologie.
Mehrgardt, O. (1995): Die originale Aussage als Bedingung im Lernprozeß. In: Mehrgardt, O. / Stolpe, A.: Eigenständiges Denken in der Schule. Kiel: Schmidt & Klaunig, 29-60.
Metzger, W. (19542): Psychologie. Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experiments. Darmstadt: Steinkopff.
Niedersen, U. (Hg.) (1990): Selbstorganisation. Jahrbuch für Komplexität in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Bd.I. Berlin: Duncker & Humblot.
Offe, S. & Schurian, W. (1981): Selbstorganisation, Gestalt. Gestalt Theory 3, 79-91.
Perls, F. / Hefferline, R. / Goodman, P. (1951): Gestalt Therapy. London: Souvenir Press.
Perls, F. / Hefferline, R. / Goodman, P. (1991 a): Gestalttherapie. Grundlagen. München: dtv/ Klett-Cotta.
Perls, F. / Hefferline, R. / Goodman, P. (1991 b): Gestalttherapie. Praxis. München: dtv/ Klett-Cotta.
Popper, K. (1999): Die evolutionäre Position der Evolutionären Erkenntnistheorie. In: Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. München: Piper.
Portele, G. (H.) (1989): Autonomie, Macht, Liebe. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Portele, G. (H.) (1992): Der Mensch ist kein Wägelchen. Köln: Edition Humanistische Psychologie.
Portele, G. (H.) / Roessler, K. (1994): Macht und Psychotherapie. Ein Dialog. Köln: Edition Humanistische Psychologie.
Richter, H.-E. (2004): Das Unbehagen für kritische Aufklärung nutzen. In: Deutsches Ärzteblatt/ PP 6, 275–277.
Riegas, V. / Vetter, C. (Hg.) (19912): Zur Biologie der Kognition. Ein Gespräch mit Humberto R. Maturana und Beiträge zur Diskussion seines Werkes. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Rosenbaum, R. (1982): Paradox as Epistemological Jump. Family Process 21, 85-90.
Rumpler, P. (1996): Die Gestalt der Seele - Die Seele der Gestalt. Gestalttherapie 1, 84-100.
Schiepek, G. (Hg.) (1987): Systeme erkennen Systeme. Individuelle, soziale und methodische Bedingungen systemischer Diagnostik. München: Psychologie Verlags Union.
Schmidt, S. (Hg.) (19903): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Schmitz, H. (1989): Leib und Gefühl. Paderborn: Junfermann.
Stadler, M. / Kruse, P. (1986): Gestalttheorie und Theorie der Selbstorganisation. Gestalt Theory 8, 75-98.
Stadler, M. / Kruse, P. (1991): Über Wirklichkeitskriterien. In: Riegas, V. / Vetter, C. (Hg.) (1991).
Stierlin, H. (1992): Von der Psychoanalyse zur Familientherapie. München: dtv/ Klett-Cotta.
Störig, H. J. (1998): Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Frankfurt a. M.: Fischer.
Teschke, D. (1989): Der radikale Konstruktivismus und einige Konsequenzen für die therapeutische Praxis. Gestalttherapie 1, 16-29.
Teschke, D. (1996): Existentielle Momente in der Psychotherapie. In: Gestalttherapie 1, 71-83.
Watzlawick, P. (Hg.) (19906): Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper.
Weischedel, W. (198715): Die philosophische Hintertreppe. München: dtv.
Wheeler, G. (1993): Kontakt und Widerstand. Köln: Edition Humanistische Psychologie.
Wilber, K. (1997): Die vier Gesichter der Wahrheit. Transpersonale Psychologie und Psychotherapie 1, 4-17.
Zillig, W. (1992): Ethische Implikationen der Gestalttheorie. Gestalt Theory 3, 174-195.
Zimmerli, W. (1989): Technik als Natur des westlichen Geistes. In: Dürr, H.-P. / Zimmerli, W. (Hg.): Geist und Natur. Bern: Scherz.
[3] Ich verwende aus Gründen der Lesbarkeit abwechselnd maskuline und feminine Bezeichnungen.
[4] Vgl. Foucaults Analogien zwischen Prostitution und Medizin (1998, 12 f., 16).