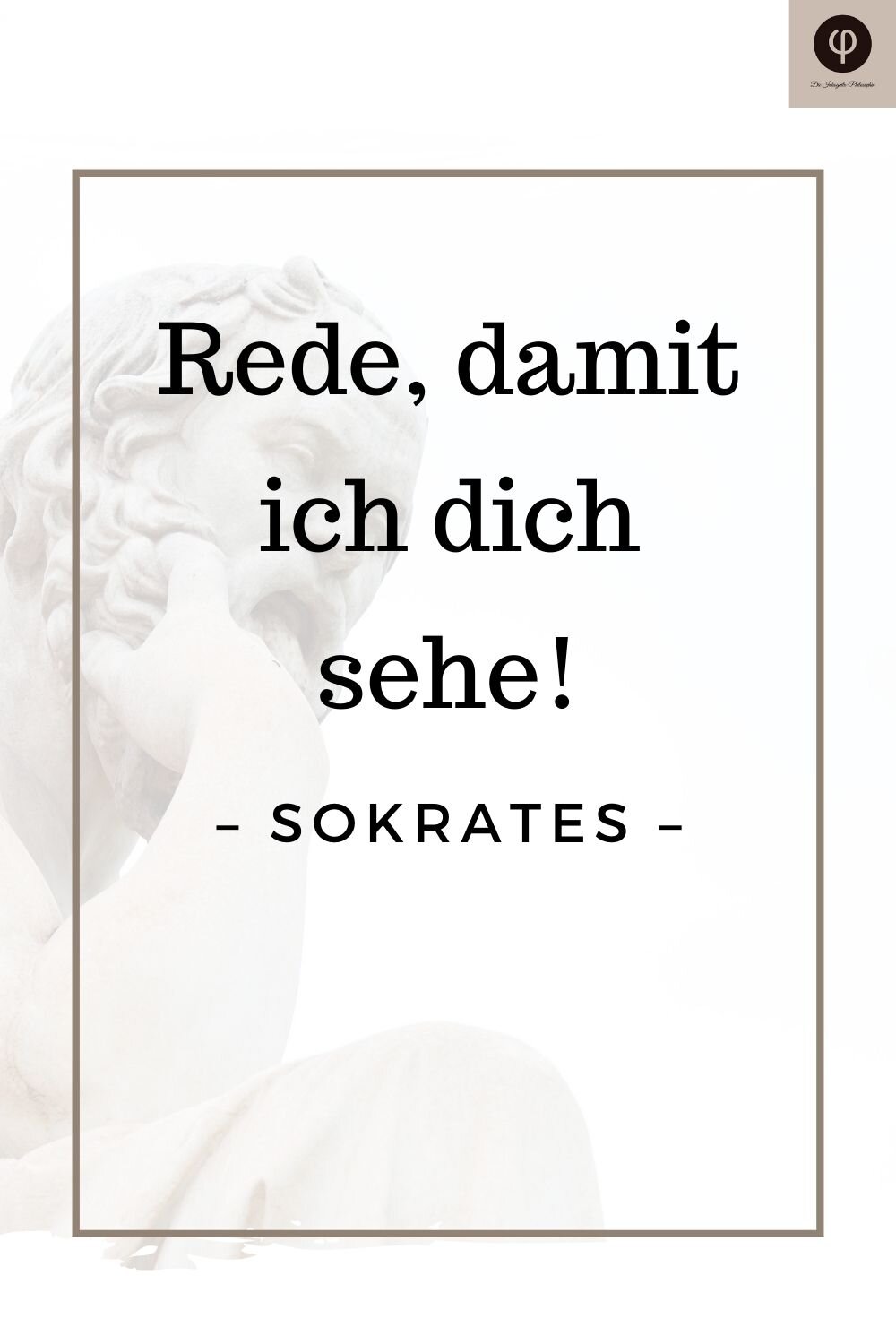Ich weiß, dass ich nichts weiß – Sokrates & das Wissen
“Ich weiß, dass ich nichts weiß“ ist ein Spruch des antiken Sokrates. Aber was bedeutet das Zitat eigentlich im Detail? Leider wird es oft falsch übersetzt & falsch verstanden. Was der alte Sokrates mit dieser Aussage wirklich meinte, ist die Haltung des Menschen zum absoluten Wissen.
Sokrates 469-399 vor Chr.
Sokrates war ein für das abendländische Denken grundlegender griechischer Philosoph, der in Athen zur Zeit der Attischen Demokratie lebte und wirkte.
„Ich weiß, dass ich nicht weiß“
Eigentlich ist das kein Original-Zitat von Sokrates, sondern ein verkürzter Spruch, der aus seiner Verteidigungsrede (Platon: Apologie des Sokrates) entlehnt wurde.
Dort heißt es: „Allein dieser doch meint zu wissen, da er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“
Übersetzungsfehler: Ich weiß, dass ich nichts weiß
Trotzdem waren die Worte des Sokrates wohl bereits in der Antike als geflügeltes Wort bekannt: „oîda ouk eidōs“ wurde aber oft falsch übersetzt und verfälscht die Aussage des Spruches. Denn sinngemäß sagt Sokrates: „Ich weiß als Nicht-Wissender“ bzw. „Ich weiß, dass ich nicht weiß“. (Das ergänzende „-s“ ist hier falsch).
Das klingt im ersten Moment paradox, denn auch das Wissen über das Nicht-Wissen ist ein Wissen, das entsprechend nicht sicher wäre. In Platons „Apologie“ spricht Sokrates 5 Mal ausdrücklich über sein Nicht-Wissen. Er behauptet jedoch nirgendwo (wie die Übersetzung von Cicero vorgibt), sein Bewusstsein für seine eigene Unwissenheit sei eine Art sicheren Wissens.
Mit seiner Aussage behauptet Sokrates also nicht, dass er nichts wisse. Vielmehr hinterfragt er das, was man zu wissen meint.
Der Hintergrund:
Sokrates & das Orakel von Delphi
Sokrates’ Freund Chairephon hatte das Orakel von Delphi gefragt, ob jemand weiser sei als Sokrates. Darauf habe die Hohepriesterin Pythia geantwortet, dies sei nicht der Fall.
Das Orakel von Delphi war eines der wichtigsten Heiligtümer im antiken Griechenland. Die Menschen pilgerten dorthin, um sich eine Antwort auf wichtige Lebensfragen von der blinden Priesterin Pythia geben zu lassen. Sogar die Obersten der Politik versuchten über das Orakel wichtige Aussagen und Hinweise für Kriege, Verhandlungen etc. zu gewinnen.
Als Sokrates davon erfuhr, konnte er es nicht glauben. Daraufhin suchte er Gelehrte und Weise auf, um sie zu befragen. Allerdings erwiesen sich diese Leute ein begrenztes oder falsches Wissen auf.
„Von da ging ich zu einem anderen, den man für noch weiser hält als jenen. Dort bekam ich genau denselben Eindruck und machte mich auch bei diesem und dann noch bei vielen anderen unbeliebt. Daraufhin fuhr ich nun der Reihe nach fort und merkte dabei mit Betrübnis und Erschrecken, dass ich mir immer mehr Feinde machte.
Dennoch schien es mir nötig, dem Götterspruch größtes Gewicht beizulegen. Darum musste ich zu all denen gehen, die etwas zu wissen schienen, um zu sehen, was das Orakel meine.“ (Platon: Apologie des Sokrates)
Sokrates in der Rolle des Nicht-Wissenden
Er bezog den Standpunkt, stellte Fragen, wies auf Widersprüche und Lücken in den Antworten hin und so erst, schrittweise, entstand Wissen. Das Orakel von Delphi hatte Sokrates also wegen seiner Haltung zum Wissen gewählt, nicht wegen seines Wissens. Sokrates selbst interpretiere das Orakel so, dass er damit die Inschrift des delphischen Tempels erfüllte – Erkenne dich selbst!
Ich weiß, dass ich nicht(s) weiß
Echtes Philosophieren setzt das Bewusstsein des Nicht-Wissens voraus. Das vermeintliche Wissen ist nur ein unreflektiertes Für-selbstverständlich-Halten, das sich bei näherem Hinsehen als Scheinwissen entlarvt.
Das sind Dinge, in denen sich Sokrates in der Tradition von Heraklit & anderen vorsokratischen Philosophien bewegt.
Das Nicht-Wissen des Sokrates bezieht sich auf die vollständige definitorische Erfassung des Guten & der Tugenden, die auch ihm nicht gelingt.
„Sokratisches Philosophieren sieht seine Aufgabe darin, dieses ahnende Verstehen des Guten, das vielerlei Irrtum zulässt, zum deutlichen Wissen emporzuheben; dieses Wissen ist zugleich die von Sokrates geforderte Selbsterkenntnis, in der das Selbst teleologisch vom Guten her in der Einheit seines Lebens verstanden wird. […]
Gesucht wird im Guten als dem wahrhaft Nützlichen das Ziel, auf das der Mensch als Mensch hin angelegt ist, in dem das Selbst sich erst wahrhaft versteht und als eigentliches Selbst im Leben verwirklicht“ (H.-D. Voigtländer: Der Wissensbegriff des Sokrates)
Weisheit beginnt für Sokrates mit der Entlarvung des Scheinwissens
Das Mittel dazu ist sein stetiges, bohrendes Hinterfragen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Sokrates will den „besten Logos“ zur Sprache bringen, das von Zeit und Örtlichkeit unabhängige, sich gleichbleibende Wesen der Sache.
Sokratische Philosophie bedeutet eine innere Bewegung, eine Haltung, die Denken und Dasein bestimmt, was sich in der Übersetzung des Wortes Philosophie als „Liebe zur Weisheit“ niederschlägt.
Sokrates über Wissen & Scheinwissen
Philosophen waren der Gesellschaft oft unbequem, weil sie unangenehme Fragen stellten. Philosophie, die Liebe bzw. das Streben zum Wissen, ist kein Sammelsurium von Antworten auf existenzielle Fragen, sondern das Bemühen, mögliche Antworten zu finden. Oder bessere Fragen. Anstatt Traditionen, die Meinung der Vielen & Autoritäten fraglos zu adaptieren und naiv seinem Bauchgefühl zu folgen, geht es darum, Vernunft und Wissen zu benutzen.
Sokrates Interpretation umstritten
Der Text sagt eigentlich nur aus, dass Sokrates sich bewusst ist, dass er kein absolutes oder unanzweifelbares Wissen besitzt. Sokrates selbst löst dieses Rätsel um sein Nicht-Wissen nicht auf. Und auch Platons andere frühen Dialoge enden häufig ohne Antworten, sondern in Verwirrung.
„Beim Weggehen aber sagte ich zu mir: ‚Verglichen mit diesem Menschen bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Rechtes; aber dieser glaubt, etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß; ich dagegen weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen.
Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube.’“ (Apologie des Sokrates)
“Ich weiß, dass ich nicht weiß” als Kern von Moral & Tugend
Die Interpretation über die Bedeutung des Nicht-Wissens stammt weitestgehend von der Neuzeit.
Auch ich habe weiter oben die Rolle des Nicht-Wissens auf absolutes Wissen bezogen.
Wenn wir genau sind, ist die sokratische Skepsis aber nicht so umfassend gedacht.
Sie soll nicht das Alltagsbewusstsein erschüttern und alles und jeden hinterfragen.
Jedenfalls bietet sich folgende Interpretation an:
Das erste „ich weiß“ bezieht sich auf die unvollständige, menschliche Erkenntnisfähigkeit. Folglich liegt die Bedeutung nicht so sehr in dem konkreten Inhalt seines Wissens, sondern eher in das Nachdenken über und Prüfen seines Wissensverständnisses.
In Bezug auf seine Dialogpartner ist er der Einzige, der seine totale Unwissenheit eingesteht, wodurch er de facto das größte menschliche Wissen besitzt.
Das folgende „dass ich nichts weiß“ bezieht sich wiederum auf ein absolutes, göttliches Wissen.
Sokrates könnte damit also aussagen, dass er als Mensch niemals das gleiche, absolute Wissen der Götter erlangen kann.
Das Wissen von der Seele (Seelenfürsorge)
Sokrates geht es ganz speziell um das Wissen von der Seele (Selbstfürsorge)– also ein moralisches Wissen. Ihn interessieren nicht naturwissenschaftliche oder mathematische Erkenntnisse, sondern „nur“ das Wissen um Gut und Böse.
Einige Zeitgenossen des Sokrates sahen seine Philosophie als destruktiv an, indem sie alle Gewissheiten aufhebe. Dabei ist die sokratische Philosophie konstruktiv gedacht:
Sie inspiriert zu einer bewussten Zukunftsgestaltung und befreit von übernommenen sinnlosen Lebensformen.
Der Sokratische Weg zum Wissen
Sokrates zeigte, wie es im Gespräch mit anderen möglich war, zu einem tieferen Verständnis der Dinge zu gelangen. Seine Methoden beruhen im Grunde auf 3 einfachen Prinzipien:
Dialog & Diskussion,
Hinterfragen fremder Gedanken,
Selbstreflexion eingegrabener Glaubenssätze.
Sokrates im Auftrag Apollons
Sokrates nennt in der Apologie den Gott Apollon von Delphi als Bürgen für die Wahrhaftigkeit seines Philosophierens. Apollon ist der Gott des Lichts und der ewigen Gegenwart.
Als Sohn des Zeus führt er einen ständigen Kampf gegen alles Dunkle. Apollon ist der Lichtbringer, er erhellt das Dunkle, das, was im Verborgenen liegt. Er ist daher gleichzeitig der Gott der Wahrheit.
Sokrates deutet den Spruch des delphischen Orakels also so, dass Apollo ihn zur Suche nach Weisheit berufen habe.
Das ist der Grund, warum der alte Philosoph so hartnäckig andere befragt, mit den Sophisten streitet und die Obrigkeit verärgert.
Die ethische Philosophie hinter dem Nicht-Wissen
Anders als die Sophisten ließ er sich nicht für seine Lehrtätigkeit bezahlen. Er philosophierte und lehrte umsonst. Allerdings war Sokrates auch nicht arm.
Sokrates’ Lebensziel war es, ein sicheres Fundament für die menschliche Erkenntnisfähigkeit zu finden. Er glaubte, diese unerschütterliche Basis liege in der Vernunft.
Er war davon überzeugt, dass derjenige, der wisse, was gut ist, auch das Gute tun werde. So postulierte er die richtige Erkenntnis, die zum richtigen Handeln führen sollte.
Das Besondere an Sokrates’ Philosophieren liegt außerdem in seiner stetigen Offenheit, die grundlegenden erkenntnistheoretischen und logischen Prinzipien des menschlichen Wissens über Tugenden und das Gute zu hinterfragen.
Bei diesen Erkundungen tritt er wiederholt an die Grenzen des menschlichen Wissensvermögens. Sokrates’ Philosophie transformiert sich zu einem Prozess, der die Verbindung von Individuum und Wissen verdeutlicht (vgl. Gernot Böhme).
Fazit: “Ich weiß, dass ich nichts weiß”
Philosophieren ist Selbstverwirklichung
Philosophieren ist Menschwerdung für Sokrates. Nur wer das Richtige tut, wird zu einem richtigen Menschen, in dem sich das Gut-sein erfüllt.
Wenn ein Mensch falsch handle, so tue er das aus Sokrates’ Sicht nur, weil er es nicht besser weiß.
Darum ist es Sokrates wichtigstes Anliegen, die Weisheit bzw. das Wissen zu vermehren.
Quellen:
1) Platon: Apologie des Sokrates
2) Platon: Die Sophisten
3) Platon: Der Staat