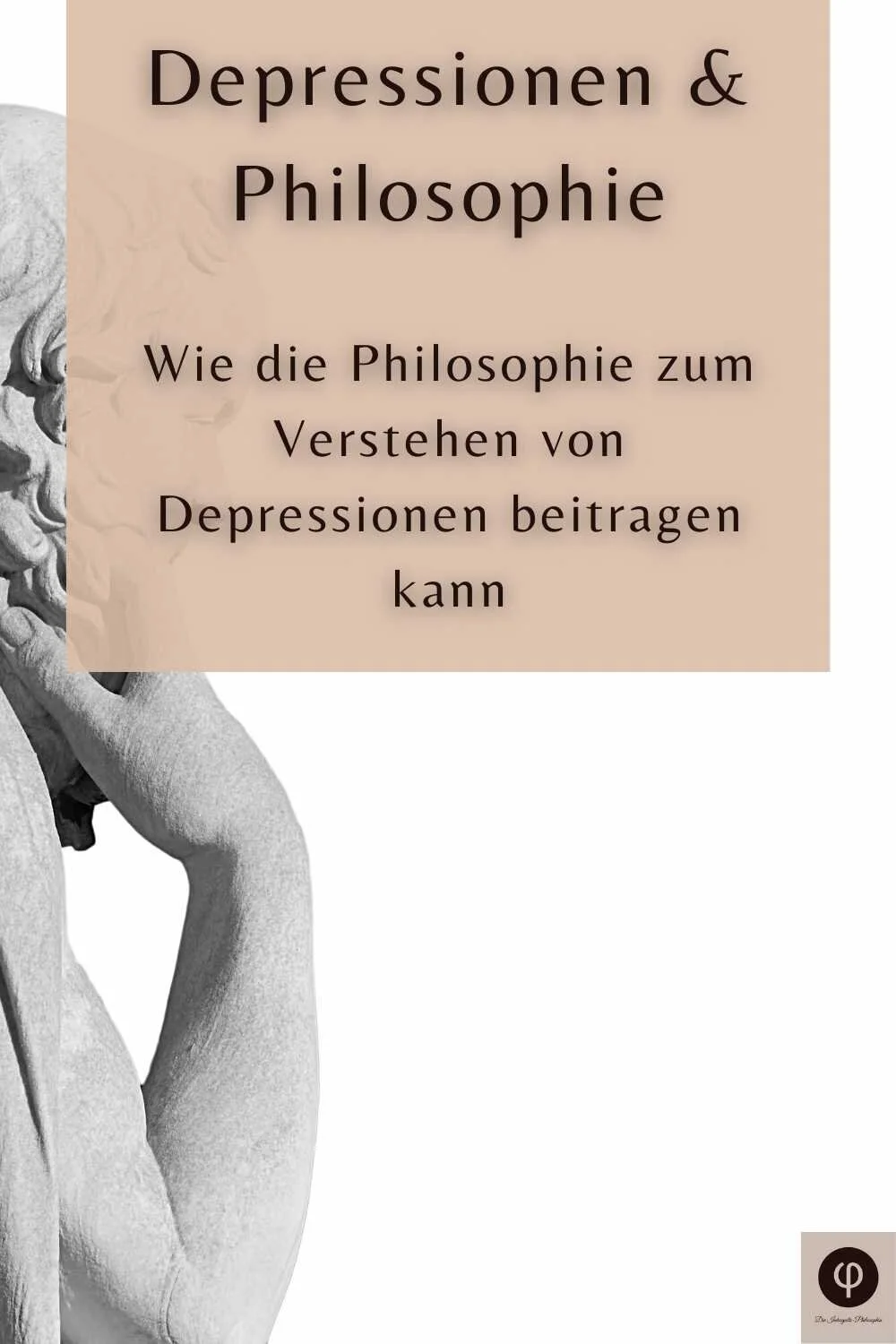Philosophie & Depression – Depressionen philosophisch verstehen
Depressionen zu erklären, ist fast unmöglich. Sie liegen an der Grenze des Sprachlichen, sie sind unsagbar. Doch die Philosophie kann helfen, das existenzielle Vakuum von depressiven Menschen in eine verständliche Sprache zu übertragen, die Betroffenen und ihrem Umfeld hilft, die Schwere von Depressionen zu verstehen.
Dieser Artikel ist eine verkürzte Fassung aus meinem Buch über Depressionen
Depressionen erklären mit Philosophie
Philosophische Ansätze können Dir helfen, die depressive Existenzkrise mit all ihrer Gewalt & Macht besser zu verstehen & anderen Menschen zu beschreiben.
Vgl. Philosophie und Psychologie
Vgl. auch: Was ist Philosophie?
Depressionen verstehen mit Philosophie
Leidest Du an Depressionen, ist Dein existenzielles, absolutes Leid unglaublich schwer in Worte zu fassen. Als Betroffener kannst Du Deinen Zustand nicht angemessen artikulieren, keine Rede kann die Krankheit in ihrem Sein richtig erfassen.
Klar, es gibt Symptombeschreibungen wie Verlust an Interesse, Anhedonie (=Freudlosigkeit), Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Gefühl der Gefühllosigkeit – aber was sagt das einem Außenstehenden? Die Begriffe sind richtig, aber erfassen nicht die Tiefe Deiner leidvollen Existenz.
Karl Jaspers, der Psychiater unter den Existenzphilosophen, setzte (gemäß Dilthey) einen Unterschied zwischen Erklärung und Verstehen in der Psychopathologie:
Erklären = Psychische Phänomene werden von der Warte einer 3. Person betrachtet und objektiv beschrieben. Möglichst auch in eine Ursache-Wirkung-Reihenfolge gebracht. Dieses Modell setzt er mit den Naturwissenschaften gleich.
Verstehen = Hier steht Empathie im Mittelpunkt, um die Sinninhalte des Erlebens zu erfassen. Dieses Modell findet sich in Literatur, Kunst, Humanwissenschaften.
Dabei stützt sich der philosophierende Psychiater auf die Phänomenologie des Philosophen Edmund Husserl. Phänomenologisch meint, alle wesentlichen Strukturen der menschlichen Erfahrung zu beschreiben. Und zwar körperliche, kulturelle und subjektive Faktoren des Menschen in der Welt.
Und tatsächlich lässt sich mit so einem philosophischen Ansatz, die existenzielle Leere (Sinnkrise) in der Depression erklären, die Sprachbarriere überwinden, so dass vielleicht mehr Außenstehende verstehen können. (Vgl. auch Depressive verstehen – 5 Punkte im Umgang mit depressiven Menschen)
Philosophie der Depression 1
Verfremdung der Lebenswelt
Als Mensch mit Depressionen fühlst Du Dich in Dir selbst gefangen.
Als würdest Du durch eine gläserne Wand vom Rest der Welt und den Menschen getrennt sein. Allein mit Dir und Deinen verzweifelten negativen Gedanken und Gefühlen.
Genau das trifft es auch. Depressionen verändern nicht einen Gedanken, sie befallen nicht nur ein Gefühl. Depressionen sind mehr als traurig sein, ängstlich sein oder weniger Hoffnung haben.
Depressionen verändern Deine wesenhafte Struktur, den Rahmen, in dem Du denkst, fühlst und wahrnimmst. Husserl spricht von Lebenswelt. Damit meint er die unreflektierte Erfahrung Deiner Welt: das automatische Denken und Handeln im Alltag, das Du gar nicht bewusst in Frage stellst, weil es so selbstverständlich ist.
Die Depression wird nicht in Dir als Person verortet, sondern Du als Person in Deiner Krankheit. Du bist von der Welt entfremdet.
Denk’ bitte mal kurz darüber nach: Entfremdung heißt, Dich in einer unheimlichen und unbekannten Umgebung zu bewegen. Deine Lebenswelt wandelt sich in der Depression zu einem Ort der Fremde, Einsamkeit und Bedeutungslosigkeit.
Vgl. auch Einsamkeit in der Depression – existenziell einsam sein
Deine Umgebung, alles außerhalb von Dir, wirkt auf Dich dumpf und surreal. Der Zugang zur Welt ist Dir abhanden gekommen. Du findest nicht mehr hinein in ihre Werte, ihr Wesen, ihren Sinn.
Gerade darum fällt es Dir als Betroffener auch so schwer, Worte für diese Unwirklichkeit zu finden. Sie ist mit einfachen Begriffen so gut wie unbeschreibbar, dem gesunden Denken nicht fassbar. Mehr dazu: In der Depression – Die Verfremdung der Lebenswelt
Philosophie & Depression 2
Die Korporifizierung des Leibes
Depressionen sind nicht nur eine geistige Krankheit, sie sind auch eine körperliche Erkrankung. Nicht umsonst haben viele Betroffene mit Herzbeschwerden, Schwindel, Rückenschmerzen, Augenproblemen der Magen-Darm-Dysfunktionen zu kämpfen.
Der Dualismus von Psyche und Körper hat eine lange Tradition in der Philosophie- & Medizin-Geschichte. Heute sind wir mit der Psychosomatik etwas weiter, wir wissen, dass sich Psyche und Körper gegenseitig beeinflussen, in einer Beziehung stehen.
Mehr unter » Leib & Leiblichkeit – Körper haben, Leib sein
Wie das funktioniert, bleibt ein Rätsel: der Zusammenhang von Geist und Körper wurde immer wieder ergründet, verworfen, entdeckt, aber kann bis heute nicht vollständig erklärt werden. Auch hier kann Dir die phänomenologische Anthropologie nach Jaspers und Husserl verstehen helfen.
Als Mensch hast Du nicht nur einen Körper, sondern auch einen Leib:
Körper = das physiologische und objektivierbar Körperliche, das Du visuell und haptisch fassen kannst
Leib = das Instrument, mit dem Du die Zeit, den Raum & Deine Umwelt erfahrbar machst und das in allen Gefühlen und Handlungen mitwirkt.
Bist Du depressiv, dann ist diese Dialektik von Leib und Körper gestört, die Du als Mensch für Deine Existenz & Dein Verständnis benötigst.
Der Leib ist nicht länger Dein Medium, um einen Zugang zur Welt und dem Leben zu finden. Er wird objektiviert und erstarrt, er lebt nicht mehr.
Die Depression macht Deinen Leib, die innerpsychische Bedeutung Deines Körpers, zu einem Leichnam.
Du bist eingeschlossen in einem toten Gefäß. Deinen Körper spürst Du nur noch als Missempfindung: er schmerzt, ist energielos, extrem schwer und träge.
Das ist mit Korporifizierung gemeint: eine Art fremde, leblose Hülle.
Dein Leib reagiert nicht mehr auf Deine Emotionen und Deine Erfahrung. Kein Gefühl ist mehr so intensiv, wie es vorher war. Nichts weiter als eine seltsame Traurigkeit und Dumpfheit kommt zustande, die viele als innere Leere beklagen.
Depression philosophisch erklären 3
Störung des Zeitbewusstseins (Chrono-Pathologisierung)
Die Störung des Zeiterlebnisses wird in der Fachsprache Chronopathologie genannt. Sie ist die Wissenschaft von den Veränderungen der biologischen Rhythmen eines Individuums vor, während oder nach funktionellen Störungen oder organischen Krankheiten.
Für die antiken Griechen hatte die Depression schon immer eine zeitliche Dimension. Daher galt Chronos nicht nur als Gott über die Zeit, sondern auch als Gott der Melancholie, der Lähmung und des Stillstands.
Als Depressiver erlebst Du Zeit anders, Dein Zeitempfinden wird gestört und verzerrt. Das ist nichts, was Du mit einem Schulterzucken abtun kannst. Denn Dein Zeiterleben ist wesentlicher Bestandteil von der Kontinuität Deines Seins.
Deine innere Uhr verlangsamt sich. Und zwar offensichtlich: viele Menschen mit Depressionen zeigen verlangsamte Bewegungsmuster, Gestik und Mimik. Auch die Einschätzung von Zeit ist für Dich gedehnt. Der Augenblick wird für Dich zu einem zähen Wabern, quälend und erdrückend.
Es geht aber noch weiter: Störung von Zeitlichkeit durch eine Depression heißt, Dein inneres Zeitbewusstsein von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geht verloren. Da ist nur noch Vergangenheit und Gegenwart, die chaotisch ineinanderfließen und Deinen Sinn für die Zukunft abschneiden.
Als depressiver Mensch erfährst Du Deinen Zustand daher als endlos, zeitlos, nicht verbesserbar. Du kannst ja die Zukunft nicht mehr geistig erfassen. Eine Zeit in der Zukunft ist für Dich nicht mehr vorstellbar.
Wenn es keine Zukunft mehr gibt, dann steht Deine Welt quasi still. Sie wird leblos & leer. Während Deine Vergangenheit Dich heimsucht und Dir schwerste Schuldgefühle beschert. Während die Gegenwart Dich durch ihre zähe, unförmige Wirklichkeit erdrückt.
Depression verstehen mit Philosophie 4
Störung der Interaktionsfähigkeit (Desynchronisierung)
Als Depressiver verliert für Dich alles seine Selbstverständlichkeit. Ausnahmslos alles. Die Gemeinsamkeit, die jeden Menschen in seinem Selbstverständnis mit anderen Menschen verbindet, ist gebrochen.
Du nimmst die Menschen um Dich herum, egal wie vertraut sie Dir vorher waren, als fremd und entfernt war. Da gibt es nichts mehr, was Dich mit dem Mensch-Sein verbindet, nichts was Dich zum Menschen unter Menschen macht. Philosophen sprechen hier von existenzieller Einsamkeit.
Diese Entfremdung hat mit der Korporifizierung Deines Leibes zu tun, der Dir nicht mehr den Resonanzraum bietet, den Du zur Interaktion mit anderen Menschen benötigst. Doch auch das gestörte Zeiterleben sorgt für diese vollkommene Isolation.
Vgl. auch Existenzängste & Sinnkrise – Zur Bedeutung existenzieller Krisen
Der Kontrast zwischen Dir und den anderen Menschen zeigt sich in Deiner Wahrnehmung grausam und angsterregend: Alle leben, verändern sich, freuen sich, haben Erfolge – nur Du selbst bleibst zurück.
Oder anders gesagt: Das blühende Leben spielt sich unmittelbar vor Deinen Augen ab, doch Du kannst weder daran teilnehmen noch es spüren.
Die Scham über Deine Andersartigkeit, Deine Unfähigkeit „normal“ zu leben, erstickt jegliche Interaktion im Keim: Du kannst nicht mehr mit anderen kommunizieren, Du kannst nicht mehr mit ihnen handeln, Du kannst nicht mehr mit ihnen sein.
Diese Erfahrung ist so unglaublich schmerzhaft und schambehaftet, dass Du Dich in einem Strudel aus Einsamkeit, Isolation, sozialem Rückzug und Kontaktabbruch wiederfindest.
Durch Philosophie Depressionen erklären 5
Menschlicher Freiheitsverlust
Jeder mit Depressionen weiß, wie wahnsinnig schwer es ist, einem geregelten Alltag nachzugehen. Jede Aktion, jede Handlung wird zur unüberwindlichen Herausforderung. Du fühlst Dich permanent zu Tode erschöpft, hilflos und kraftlos.
Manche erleben sogar einen depressiven Stupor. Ein Zustand der Lähmung, in dem Du Dich kaum noch richtig bewegen oder artikulieren kannst.
Wichtig: das ist nicht einfach Antriebslosigkeit. Es ist ein Defizit an handlungsfähiger Lebendigkeit, an Vitalität. Eine extreme Einschränkung Deiner Freiheit.
Mit Sartre gesprochen, ist Deine Freiheit nämlich keine Kopfsache, sondern eine spezifische Art und Weise, die Welt zu erfahren.
Anders ausgedrückt: Deine Welt, in der Du lebst, ist nicht eine Anhäufung von Objekten und Geschehnissen, sondern ein Raum von Möglichkeiten, den Du als Mensch zur Orientierung benötigst.
Weil Deine Lebenswelt aber verändert ist, sich in eine fremde Dimension verwandelt hat, verfügst Du auch nicht mehr über Freiheit. Die Depression bestimmt, welche Möglichkeiten Du noch hast und welche nicht.
So schrumpft nicht nur Dein Erfahrungshorizont, sondern auch Dein Denkvermögen auf eine Enge zusammen. Du hast keine Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit mehr. Nur den kleinen Raum, den die Depression Dir vorgibt.
Vgl. auch Depression als Schutz – Welchen Sinn haben Depressionen?
Fazit: Philosophie & Depression verstehen
Depressionen lassen sich weniger naturwissenschaftlich beschreiben als philosophisch verstehen
Depression sind eine Verfremdung der Lebenswelt: Die Krankheit verändert den kognitiven und emotionalen Rahmen, in dem Du denkst, wahrnimmst & fühlst.
Depressionen lassen Deinen Leib erstarren als Instrument der Erfahrung von Umwelt & Sein: Du fühlst Dich fremd in Deinem eigenen Körper und Selbst.
Depressionen stören das Zeitbewusstsein: Dein Empfinden von Zeit verzerrt sich und wird auf Gegenwart und Vergangenheit reduziert.
Depressionen minimieren Handlungsfähigkeit & Selbstverständnis als Mensch in einer Gemeinschaft.
Depressionen rauben Dir Deine Willens- und Handlungsfreiheit: Die Depression gibt Dir einen eingeschränkten Rahmen vor, in dem Du Erfahren und Erleben kannst. Die Vielfalt an Möglichkeiten, die einen gesunden Menschen ausmachen, wird Dir vollständig entzogen. Du lebst buchstäblich auf engstem Raum.
Dieser Artikel ist eine verkürzte Fassung aus meinem Buch über Depressionen
Quellen:
1) Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Anthropologie, Psychiatrie und Psychotherapie (DGAP)
2) Gesellschaft für Hermeneutische Anthropologie und Daseinsanalyse (GAD)
3) Thomas Fuchs: Anthropologische und phänomenologische Aspekte psychischer Erkrankungen
4) Spektrum Lexikon der Neurowissenschaften
5) Thomas Fuchs: Melancholie als Desynchronisierung
6) Dr. med. Karl-Josef Klees: Depression und Zeit
7) Jan Slably und Achim Stephan: Depression als Handlungsstörung
8) Dtv Lexikon der Philosophie
9) Prof. Dr. med. Dr. phil. Hinderk M. Emrich: Vom Sinn der Depression
10) Bernd Schuppener: Seelennot - Essay über die Philosophie der Depression
11) Dan Zahavi: Phänomenologie für Einsteiger
12) Jannis Puhlmann: Depression und Lebenswelt. Eine phänomenologische Untersuchung