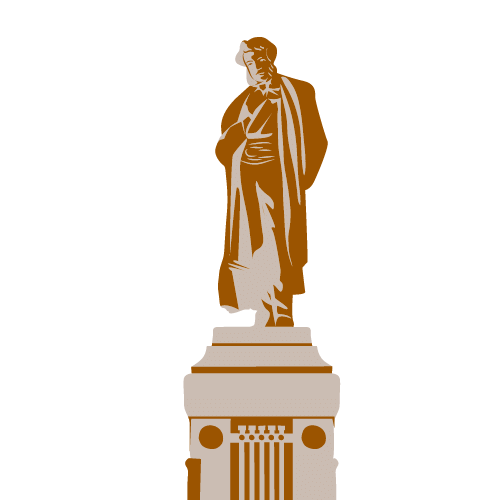Was ist philosophieren? – Philosophieren als Lebenskunst
Philosophieren ist eine geistige Tätigkeit, die mithilfe des Verstandes ausgeübt wird. Dabei strebt die Philosophie nicht nur nach Erklärungen dessen, was ist, sondern auch nach einem tiefgreifenden Verständnis dessen, was sein könnte oder sein sollte. Das betrifft grundlegende Fragen des menschlichen Daseins, des Wissens, der Werte, des Geistes, der Sprache und der Realität.
Vgl. auch Philosophieren mit Kindern – Staunen, Sinnfragen & Bedeutung
Zur Bedeutung des Philosophierens
Heute ist der Titel Philosoph heiß begehrt. Daher finden sich mittlerweile unzählige Beschreibungen darüber, wie sich Philosophie definiert und was ein Philosoph sein soll (vgl. auch: Was ist Philosophie?).
Doch eine einheitliche Definition existiert bis heute nicht.
Warum philosophieren?
Philosophie ist eine Geisteswissenschaft, aber eigentlich keine „normale“ Wissenschaft (vgl. Ist Philosophie eine Wissenschaft?). Andererseits soll jeder irgendwie mal philosophieren, vorwiegend über den Sinn des Lebens (Philosophie). So beliebt war das Philosophieren bzw. der Stand des Philosophen aber nicht immer, es ist viel mehr ein Merkmal der Neuzeit und Moderne.
Das Wort „philosophieren“ setzt sich aus den altgriech. Begriffen für Freundschaft, Zuneigung, Liebe (philo) und Wissen, Weisheit, Kenntnis (sophia) zusammen. Viele übersetzen Philosophie (ποιλοσοφία) mit Liebe zur Weisheit, philosophieren wäre dann die aktive Form der Weisheitsliebe.
Die Philosophie und Philosophieren kann aber auch weniger hochtrabend die Leidenschaft zum Wissen und sich leidenschaftlich mit Wissen auseinandersetzen bezeichnen.
Soweit die kurze Antwort.
Doch um das Philosophieren zu verstehen, musst du mehr zum Hintergrund erfahren.
„Wenn zwei Philosophen zusammentreffen,
ist es am vernünftigsten, wenn sie zueinander
bloß ‘Guten Morgen’ sagen.“
Inhaltsverzeichnis: Philosophieren
Jaspers: Philosophieren ist Existenzerhellung
Existenzerhellung
Grenzsituationen
Transzendenz
Was philosophieren nicht bedeutet …
Fazit: Philosophieren
Wann beginnt man zu philosophieren?
Am Anfang der Philosophie steht das Staunen und mit ihm die Neugierde, herauszufinden, was es mit dem Bestaunten auf sich hat.
„Das Staunen ist die Einstellung eines Mannes, der die Weisheit wahrhaft liebt, ja es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen“, sagte Sokrates einst.
Indem Du Dich also über etwas verwunderst, trittst Du aus Deinem Alltags-Bewusstsein heraus und wendest Dich offen zu etwas hin. Du möchtest die zugrunde liegenden Prozesse oder Resultate verstehen.
Was tut man beim Philosophieren?
Philosophie zu betreiben heißt, ein bestimmtes Phänomen, Objekt oder einen spezifischen Sachverhalt zu untersuchen – entweder allein oder im Austausch mit anderen – und ausschließlich über vernünftige Zusammenhänge zu erhellen.
Das Philosophieren geht dabei weit über Alltägliches hinaus, indem es sich Selbstverständlichkeiten des Daseins zuwendet.
Zum Beispiel:
„Die Philosophie ist keine Lehre,
sondern eine Tätigkeit.“
Was bedeutet philosophieren?
Weltanschauung, Sinn des Lebens, Erkenntnisgewinn, ethische Prinzipien – das sind die Konnotationen, die heute in der Umgangssprache Verwendung finden.
Dabei ist die Frage, was Philosophie eigentlich ist, evtl. etwas zu kurz gegriffen. Im Ernst:
Es gibt keine allgemeingültige Definition von Philosophie und damit auch nicht fürs Philosophieren.
Dafür gibt es eine Unzahl an Antworten darauf, was darunter zu verstehen sein könnte. Eben je nachdem, welchen Philosophen Du liest und welcher philosophischen Richtung derjenige angehört.
Weizsäcker hat das mal ganz schön ausgedrückt: „Philosophie ist die Wissenschaft, über die man nicht reden kann, ohne sie selbst zu betreiben.“
Etymologie des Begriffes „Philosophie“
Der Begriff „Philosophie“, zusammengesetzt aus griechisch phílos „Freund“ und sophia „Weisheit“, bedeutet wörtlich: „Liebe zur Weisheit“ und “Liebe zum Wissen“ – denn sophia war ursprünglich die Bezeichnung für jede Fertigkeit oder Fachkunde, nicht nur für geistige Disziplinen.
Wann das Wort “philosophieren” zum ersten Mal in antiken, griechischen Schriften auftaucht, ist umstritten (Herodot, Pythagoras). Fest steht jedenfalls, dass bei Platon die Begriffe Philosoph und philosophieren im Sinne von Wissensdurst & Erkenntnissuche auftauchen.
So stellt Platon in seinem Dialog Phaidros fest, dass das Philosophieren und der Besitz der Weisheit sich ausschließen.
Wesensmerkmale des Philosophierens
Philosophieren konzentriert sich auf existenzielle Fragen, Mensch und Welt also.
Dabei geht es nicht darum, DIE Antwort zu finden, sondern viel mehr darum, mögliche Antworten auf ihre Berechtigung und Glaubhaftigkeit zu prüfen.
Dabei suchen Philosophen Antworten und stellen auch immer neue Fragen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. In der Philosophie gibt es verschiedene Theorien und Gedankenmodelle, die Erklärungsansätze liefern.
Philosophieren heißt, mit dem Verstand hinterfragen
Einen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben die meisten dieser gedanklichen Entwürfe nicht. Es geht Philosophinnen und Philosophen mehr um begründbare Erklärungsversuche als um allgemeingültige Wahrheiten.
Außerdem hinterfragt die Philosophie immer wieder kritisch bestehende Gesetzmäßigkeiten, Normen und Trends – aber ebenso sich selbst.
Bei dem Versuch, solche Fragen zu beantworten, bedient sich ein Philosoph seines Verstandes. Philosophieren hat also nichts mit gefühlten Einsichten zu tun und intuitiven Erkenntnissen (vgl. Bauchgefühl & innere Stimme).
Philosophieren kannst Du nur auf vernünftigem Wege, das ist ein relevantes Kriterium für Philosophie. Verstand und Vernunft heißt aber nicht zweckrational denken, sondern auch Gefühle & Stimmungen zu berücksichtigen.
Vgl. auch die Phänomenologie und der Existentialismus
„Die Philosophie bietet mir einen Hafen,
während ich andere mit den Stürmen kämpfen sehe.“
Sokrates: Philosophieren heißt sterben lernen
In Platons Phaidon versucht Sokrates die Philosophie für die praktische Lebenswelt fruchtbar zu machen. Im genannten Dialog geht Platon vor allem darauf ein, dass das Philosophieren eine Hilfe im Umgang mit dem Tod sei.
Tod und Sterben-lernen meint hier jedoch nicht den singulären Tod des Einzelnen, sondern:
Sterben = Prozess der Trennung von Körper und Seele, Loslösung von körperlichen Vorurteilen
Tod, tot sein = tatsächliches Getrenntsein von Körper und Geist
Im Gegensatz zur pythagoreisch-orphischen Mysterien-Tradition bedeutet Tod oder Sterben bei Sokrates allerdings keine wirkliche, physische Trennung von Physis & Psyche, sondern eine Trennung des Verstandes von den körperlichen und biologischen Voreingenommenheiten.
Philosophieren zeigt sich damit auch in einem sinnvollen Umgang mit dem Körper.
Philosophieren für das gute Leben
Der platonische Sokrates positioniert auf diese Weise die Philosophie als Alternative zu philosophisch-religiösen Strömungen und dem orphischen Mysterienkult seiner Zeit.
Das sind nicht irgendwelche Dinge, sondern wichtige kulturelle Diskurse und Lehren, die in antiker Zeit jeder Mensch kennt.
Philosophie konkurriert also mit den verbreiteten Glaubenssystemen zu Platons Zeiten. Das Philosophieren wird in einen spirituellen Zusammenhang gesetzt.
Platon möchte hier darstellen, wie da Philosophieren weit über eine rein theoretische Verstandestätigkeit hinaus geht, indem sie praktische Unterstützung & Orientierung fürs Leben gibt. Vgl. Sokratischer Dialog in Philosophie & Psychotherapie.
Philosophieren als Verbindung von Mythos & Logos
Die Verknüpfung mit lebensweltlichen und spirituellen Fragen schafft der platonische Sokrates über den Mythos & die Musenkunst. Da Philosophie eine musische Kunst ist, gebraucht sie nicht nur den Verstand (nous), sondern besitzt auch einen spirituell-emotionalen Charakter (mythos).
Im Klartext: Philosophieren geht weit über die gängigen, mystischen Geheimlehren der Zeit hinaus. Ja, Philosophie übertrifft die religiösen Schulen sogar durch ihre Dialektik.
Philosophieren erschöpft sich also nicht in einer reinen Intelligibilität, sondern benötigt auch den Mythos als Bild für all die Dinge, die über den menschlichen Verstand nicht erfassbar sind. Wie zum Beispiel der Tod.
Sokrates erwähnt in Platons Dialogen immer wieder, dass die Götter die Menschen zum Philosophieren auffordern – weshalb Mythos und Philosophie in engem Austausch stehen.
Philosophieren als Selbstbestimmung
Sokrates outet sich vielfach als Fan der Musenkünste. In einem Traum wird er immer wieder aufgefordert, sich musisch zu betätigen. Und das tut er im Phaidon auch: Er verfasst Gedichte, die auf Äsops Sätzen basieren, er dichtet frei für sich, hat sogar einen Lobgesang (Eloge) an Apollo gerichtet.
Indem das Mythos-Thema den Anfang und das Ende des Dialogs über den guten Tod bildet, wird die Philosophie von der Kunst eingerahmt. Zu guter Letzt macht Sokrates damit deutlich, dass ein Philosoph nicht vollständig über sein Leben verfügen kann. Jeder Mensch sei den Göttern verpflichtet, doch in der Weise, wie man sein Leben lebt, findet sich die menschliche Selbstbestimmung.
„Die Grenzen der Vernunft begreifen
– das erst ist wahrhaft Philosophie.“
Jaspers: Philosophieren ist Dialog
Karl Jaspers war ein maßgeblicher Denker der Existenzphilosophie, einer philosophischen Richtung, die das individuelle Dasein, die Freiheit und die Entscheidungen des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt.
Philosophie, so Jaspers, ist nicht ein festes System von Doktrinen oder ein Katalog abschließender Antworten, sondern ein fortwährender Prozess der Reflexion. Damit ist Philosophieren für ihn, eine lebendige, dynamische Tätigkeit, die sich an der Grenze dessen vollzieht, was ausgesprochen werden kann und was letztlich unauflösbar bleibt.
Dieser „Grenzgedanke“ ist zentral in seinem Werk; es ist der Punkt, an dem das Denken seine eigenen Grenzen erkennt und sich der Ungewissheit und den existenziellen Fragen des Lebens stellt.
Jaspers war überzeugt davon, dass echte Philosophie kommunikativ sein muss und im Dialog entsteht. Er glaubte, dass durch die Kommunikation mit anderen, in einem Prozess des gemeinsamen Nachdenkens und der Konfrontation mit verschiedenen Perspektiven, die Philosophie erst ihr volles Potenzial entfaltet.
Philosophie als Existenzerhellung
Jaspers nutzt diesen Begriff, um zu beschreiben, wie Philosophie hilft, die Bedingungen und Möglichkeiten menschlicher Existenz zu erhellen. Es geht darum, das eigene Sein zu verstehen und authentisch zu leben.
Die Bedeutung von Grenzsituationen
Dies sind Momente, in denen Menschen konfrontiert werden mit Aspekten des Lebens wie Leiden, Konflikt, Tod, Zufall, Schuld und die Begrenztheit des Wissens, die nicht überwunden, sondern nur ertragen und durchlebt werden können. In Grenzsituationen entdeckt und erprobt der Mensch nach Jaspers seine Freiheit und sein Wesen.
Philosophieren als Medium zur Transzendenz
Jaspers sieht die Philosophie auch als ein Medium, durch das Menschen zu einer Beziehung zur Transzendenz, dem "ganz Anderen", gelangen können. Dieser Aspekt seiner Philosophie berührt spirituelle und metaphysische Dimensionen und beinhaltet das Streben nach Sinn sowie einer Wahrheit, die über das empirische Wissen hinausgehen.
Was ist ein Philosoph?
Im antiken Griechenland & bei den Römern war ein Philosoph jemand, der sich mit den Wissenschaften beschäftigte. Zur Philosophie zählten damals Naturwissenschaften (Naturphilosophie), Logik/Dialektik und Ethik.
Heute ist das anders. Die moderne Philosophie befasst sich mit ausdifferenzierten Fachgebieten, die damals so noch nicht existierten. Darunter zum Beispiel Psychologie, Sozialwissenschaften, Anthropologie und vieles mehr. Daraus ergeben sich auch Schwierigkeiten der Definition eines Philosophen.
So steht zum Beispiel im Duden unter “Philosoph”:
jemand, der sich mit Philosophie beschäftigt
Forscher oder Lehrer auf dem Gebiet der Philosophie,
jeder, der gerne philosophiert.
Problematisch an dieser Art der Definition ist ihre Zirkularität, wie der Philosoph Magnus Frisch richtig bemerkt.
Wie philosophiert man?
Am Beginn des Philosophierens steht immer ein Hinterfragen von dem, was Du bisher als gegeben hinnahmst. Schreibe Dir einen Glaubenssatz, eine Überzeugung, ein Prinzip auf, das Du selbstverständlich vertrittst.
Zum Beispiel: Lügen ist immer falsch. Jetzt stellst Du diese Meinung bewusst in Frage:
Gibt es an diesem Satz etwas zu korrigieren oder stimmt er für jeden gleichermaßen?
Brainstorming: Was spricht dafür, was dagegen?
Nimm dabei die Rolle der jeweiligen Perspektive ein
Gehe tiefer: Sammle Informationen, online oder in Büchern. Setze Dich mit dem Thema im Detail auseinander. Welche Positionen oder Argumente gibt es noch?
Versteife Dich nicht auf Deine Ansicht, sondern versuche auch die Argumente & Deutungen anderer nachzuvollziehen.
Wenn möglich: tausche Dich aus mit anderen.
Kernkonzepte der Philosophie
Ethik (die Untersuchung von richtigem und falschem Verhalten),
Ästhetik (die Untersuchung von Schönheit und Kunst),
Metaphysik (die Untersuchung der grundlegenden Natur der Realität)
und Erkenntnistheorie (die Untersuchung der Natur und des Umfangs von Wissen)
„Zum Philosophieren sind die zwei ersten Erfordernisse diese: erstlich, daß man den Mut habe, keine Frage auf dem Herzen zu behalten; und zweitens, daß man alles das, was sich von selbst versteht, sich zum deutlichen Bewußtsein bringe, um es als ein Problem aufzufassen.“
Was philosophieren nicht bedeutet …
1) Philosophie ist kein Geschichtsunterricht
Philosophie lehren und lernen ist ziemlich anspruchsvoll. Nur verkommt Philosophie in den Universitäten leider häufig zum Geschichts-Unterricht. Als Einführung und Inspirationsquelle solltest Du Dich unbedingt mit den alten Philosophen mal auseinandergesetzt haben. Doch die Abstraktion von alten Gedankenkonstrukten auf das Heute fehlt viel zu oft. Fast alles wird übernommen, was sich in alten Schriften wiederfindet und von der Forschung halbwegs analysiert wurde.
Das hat aber nicht mit Philosophie zu tun, sondern ist Zitieren und Paraphrasieren.
2) Philosophieren ist nicht Auswendiglernen
Philosophie ist keines von den Fächern, das daraus besteht, eine Menge an Stoff herunterzuwandern oder vermeintliche Gesetzmäßigkeiten aufzuschreiben. Man muss nicht auswendig lernen, um zu philosophieren. Auch wenn es natürlich Vorteile hat, wenn Du Dich mit der Philosophiegeschichte auskennst und einige wichtige Gedanken aus dem Effeff aufsagen kannst. Auswendiglernen ist also eine coole Ergänzung zum Philosophieren. Aber eben nicht philosophieren selbst.
Quellenstudium gehört dazu, keine Frage. Aber: das Übernehmen fremder Gedankengänge hat nichts damit zu tun. Du wirst auch kein Philosoph, indem Du alte Lehren in moderne Phrasen verpackst.
3) Philosophieren ist keine Lebensberatung
Das ist vielleicht das, was viele unter Philosophie verstehen, eine Art Religionsersatz, Therapieersatz oder Glücksfindung. Das alles hat aber mit Philosophie nicht wirklich etwas zu tun. Philosophieren macht Dich auch nicht notwendigerweise zu einem glücklichen, erfüllten Menschen.
Philosophie gibt kein Glücksversprechen
Ich sehe das ähnlich wie Richard David Precht, der in einem Interview von 2012 auf die Frage „Macht die Beschäftigung mit Philosophie glücklicher?“ antwortete:
„Nicht jeden. Philosophie erweitert den Horizont, und viele Menschen werden genau dadurch glücklicher – den Horizont zu erweitern, kann nämlich eine durchaus lustvolle Erfahrung sein.
Ich würde trotzdem nicht jedem empfehlen, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Es kann ja sein, dass ein glücklicher Mensch durch zu viel Grübeln nicht mehr ganz so glücklich ist. Ein Glücksversprechen würde ich also nicht machen wollen.“
Das kommt nämlich immer auf Deinen Typus an und wie Du die Welt siehst bzw. sehen willst. Arthur Schopenhauer war auch kein Kind von Freude. Genauso wenig Nietzsche, Kant, Søren Kierkegaard usw. (es gibt einige Beispiele). Es kommt eben auf Deine grundlegende Einstellung an.
Philosophie ist keine Lebensberatung
Leider lese ich immer wieder davon, dass Philosophie dabei helfen soll, Lebensprobleme zu bewältigen. Damit wird sie aber zum Instrument der Selbstoptimierung, anstatt Selbstzweck zu sein. Ihr wird ein konkreter Nutzen abverlangt. Das mag zwar eine erfreuliche Folge vieler philosophischer Gespräche sein, einen Nutzen daraus zu ziehen, aber dem Wesen der Philosophie wird ein reines Nutzenkalkül nicht gerecht.
Populärphilosophie ist keine echte Philosophie
Auch die zahlreichen philosophisch angehauchten Ratgeber, die sich so häufig im Handel finden, haben nichts mit richtigem Philosophieren zu tun. Es ist ein Unterschied, ob Du philosophische Fragen in verständlicher Sprache behandelst oder ob Du Populärphilosophie mit Ratgebern betreibst, die mit vielen Behauptungen und Voraussetzungen arbeiten.
4) Philosophieren ist nicht nachdenken oder grübeln
Natürlich denkst Du nach und machst Dir Gedanken über das Leben. Das macht jeder Mensch, ohne Ausnahme. Das beginnt nämlich schon im Kindesalter auf eine gewisse Art und Weise, wenn auch auf einem anderen Abstraktionsniveau. Aber würdest Du deswegen jedes Kind und jeden Menschen als Philosophen bezeichnen? Wahrscheinlich nicht.
Philosophische Fragen sind in der Moderne beliebter denn je. Das hat viel mit der Demokratisierung des Wissens zu tun: Heute können auch Menschen, die nicht zur akademischen Elite gehören, studieren. (Das war zum Beispiel ein Vorteil für meinen persönlichen Werdegang). Heute findet sich Wissen frei zugänglich im Internet oder Bibliotheken. Und angesichts der Technisierung und Globalisierung denken immer mehr Menschen über ihr Leben nach. Das ist gut so, aber noch längst nicht philosophieren.
„Wenn man etwas nicht einfach erklären kann,
hat man es nicht verstanden.“
Das Problem der Philosophie heute
Das Problem mit der umgangssprachlichen Definition von Philosophie ist gar nicht so banal. Im Gabler Metzler Lexikon für Philosophie heißt es ganz richtig:
“Die Philosophie hat einerseits ihre ehemalige Bedeutung verloren, andererseits über Sachbücher und Massenmedien neue Popularität erlangt. Ihr Potenzial wird von manchen Personen und Gruppen nicht in genügender Weise erkannt, was mit einer Begriffsverwirrung ("Philosophie" als Wort der Umgangssprache mit ganz anderer Konnotation), mit der Lobbyismustätigkeit wissenschaftsfremder, esoterischer und religiöser Kreise und mit Kompetenzstreitigkeiten zu tun haben mag.
Vor diesem Hintergrund muss sich die Philosophie, will sie sich erneut und dauerhaft etablieren, auf ihre Wesensmerkmale besinnen, muss ihre Streitlust wiederentdecken, ihren Platz an Schulen und Hochschulen zurückerobern und sich in den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Diskurs einbringen, ihren methodischen Zweifel, ganz im Sinne von Descartes, auf sich und die Welt anwendend.“
Das sehe ich ähnlich. Die akademische Philosophie wirkt oft zu abstrakt und bewegt sich im Hinterzimmer der Universität. Sie erschwert ein Verständnis durch Fachbegriffe über Fachbegriffe und unmögliche Satzkonstruktionen. Teilweise verkümmert sie sogar zum einfachen Geschichtsunterricht.
Das liegt aber auch am Selbstverständnis der akademischen Philosophen, die sich durch eine besondere Ausdrucksweise und Stilistik (die mehr verkompliziert, als klärt) von den Otto-Normal-Bürgern abheben wollen.
„Wie damals der Mönch,
so ist es jetzt der Philosoph,
in dessen Hirn die Revolution beginnt.“
Fazit: Philosophieren
Salopp ausgedrückt ist das Philosophieren die Suche möglicher Antworten auf philosophische Fragen, welche allgemein das Leben und die Gemeinschaft betreffen.
Im philosophischen Gespräch tauschen Menschen Gedanken und Erfahrungen aus, prüfen und hinterfragen Konzepte.
Philosophieren heißt aber nicht nur kritisch analysieren und In-Frage-Stellen, sondern auch konstruktive Beiträge finden und praktisch in der Lebenswelt verankern.
Philosophieren ist oft abstrakt, doch im Eigentlichen berührt es direkt unser aller Welt- und Selbstbild. Wie der platonische Sokrates zeigte, hat Philosophie eine lebensweltliche und spirituelle Komponente.
Vgl. auch bekannte Philosophinnen – 12 Frauen & ihr geistiges Erbe
Damit umfasst das tätige Philosophieren eine Ganzheitlichkeit, die im Einklang von Gedanken & Gefühlen steht und eine praktische Umsetzung benötigt, um Philosophie zu sein.
Quellen:
1) Deutscher Ethikrat
2) Dtv Atlas der Philosophie
3) Big Ideas. Das Philosophie-Buch – Großen Ideen und ihre Denker
4) Ansgar Beckermann: Was ist das – Philosophie?
5) Erich Satter: Was ist Philosophie? - Definition, Bedeutung, Aufgaben
6) Platon: Phaidon